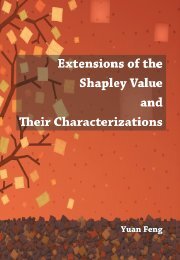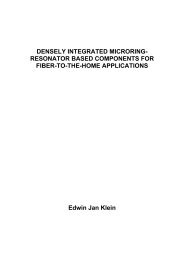WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Äußerungen bekommen also ihr Gewicht und ihre Bedeutung durch die besondere<br />
Situation der sie betreffenden Menschen.<br />
Zwei weitere Faktoren tragen zusätzlich zu der besonderen Gewichtung und in<br />
der Rezeption vollzogenen internen Vergrößerung von Prognosen bei: Da ist zum<br />
einen die genuin menschliche Versuchung in der so oft zitierten „selbstverschuldeten<br />
Unmündigkeit“ zu verharren und Verantwortung zu delegieren. Gerade im<br />
medizinischen Kontext kommt dieses Bestreben immer wieder zum Tragen: Ein Teil<br />
der Patientinnen überträgt die Sorge für ihre Gesundheit den Fachleuten und<br />
erwartet, dass diese ein aufgetretenes physisches Problem beheben wie eine<br />
Autopanne. Die Krankheit wird wie eine aus dem gesamtkörperlichen und<br />
lebensweltlichen Kontext herausgelöste Entität betrachtet, und die Bedeutung des<br />
eigenen Engagements, der Involvierung in den Heilungsprozess, wird dabei nur<br />
unzureichend wahrgenommen. Gleichzeitig kommt es zur Projektion von<br />
Allmachtsphantasien auf die Mediziner, derer diese sich nur mit Mühe erwehren<br />
können. 71 Der gängige Begriff der „Halbgötter in Weiß“ ist dafür symptomatisch.<br />
Und da ist zum andern die Haltung der Mediziner, die den Befunden<br />
zusätzliches Gewicht verleiht: Diese müssen gegenüber der allgemeinen<br />
Verunsicherung und Schwächung der Menschen, mit denen sie zu tun haben, eine<br />
Haltung finden, die Zuversicht, Beruhigung und Vergewisserung vermittelt. Eine<br />
Ärztin, die im Wissen um die Vieldeutigkeit organischer Phänomene nach außen hin<br />
allzu viele Interpretationsvarianten reflektiert, wird kaum als vertrauenswürdig<br />
wahrgenommen, auch wenn ihre Haltung den tatsächlichen Gegebenheiten vielleicht<br />
viel eher entspricht als eine mit Überzeugung und Klarheit vermittelte<br />
eindimensionale Darstellung. Dazu kommt die Versuchung, die Allmachtsprojektionen<br />
der Patientinnen mit einer übersteigerten Selbsteinschätzung zu beantworten, in dem<br />
Versuch den Erwartungen zu entsprechen. Eine verführerische und prekäre<br />
Konstellation, die sorgfältiger Reflexion seitens der Akteure bedarf.<br />
Damit beende ich diese allgemeinen Erwägungen. Das folgende Kapitel ist<br />
Entwicklungen und Prozessen gewidmet, die ihrerseits zum Teil ähnliche Fragen<br />
aufwerfen wie der Proteinchip. Danach wende ich mich dann dem ethischen Diskurs<br />
71 Außerordentlich vergnüglich ist es, Manfred Lütz’ Auslassungen zu diesem Themenbereich –<br />
beispielsweise seine Schilderung einer Chefarztvisite - zu lesen. Vgl. Manfred Lütz. 2005<br />
52