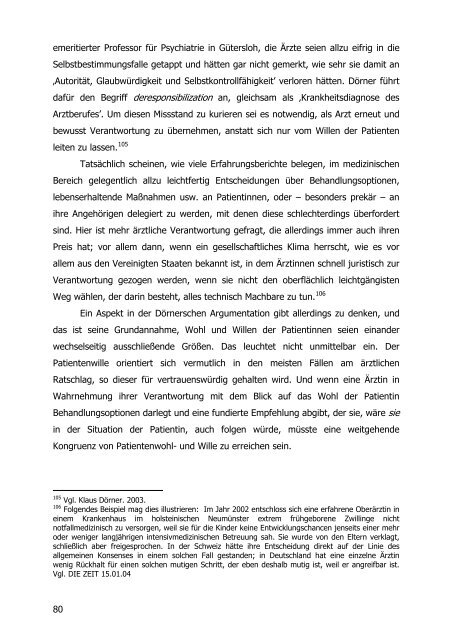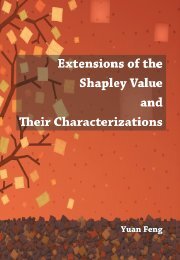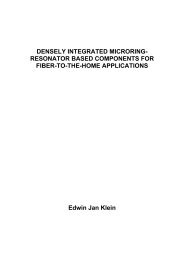WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
emeritierter Professor für Psychiatrie in Gütersloh, die Ärzte seien allzu eifrig in die<br />
Selbstbestimmungsfalle getappt und hätten gar nicht gemerkt, wie sehr sie damit an<br />
‚Autorität, Glaubwürdigkeit und Selbstkontrollfähigkeit’ verloren hätten. Dörner führt<br />
dafür den Begriff deresponsibilization an, gleichsam als ‚Krankheitsdiagnose des<br />
Arztberufes’. Um diesen Missstand zu kurieren sei es notwendig, als Arzt erneut und<br />
bewusst Verantwortung zu übernehmen, anstatt sich nur vom Willen der Patienten<br />
leiten zu lassen. 105<br />
Tatsächlich scheinen, wie viele Erfahrungsberichte belegen, im medizinischen<br />
Bereich gelegentlich allzu leichtfertig Entscheidungen über Behandlungsoptionen,<br />
lebenserhaltende Maßnahmen usw. an Patientinnen, oder – besonders prekär – an<br />
ihre Angehörigen delegiert zu werden, mit denen diese schlechterdings überfordert<br />
sind. Hier ist mehr ärztliche Verantwortung gefragt, die allerdings immer auch ihren<br />
Preis hat; vor allem dann, wenn ein gesellschaftliches Klima herrscht, wie es vor<br />
allem aus den Vereinigten Staaten bekannt ist, in dem Ärztinnen schnell juristisch zur<br />
Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht den oberflächlich leichtgängisten<br />
Weg wählen, der darin besteht, alles technisch Machbare zu tun. 106<br />
Ein Aspekt in der Dörnerschen Argumentation gibt allerdings zu denken, und<br />
das ist seine Grundannahme, Wohl und Willen der Patientinnen seien einander<br />
wechselseitig ausschließende Größen. Das leuchtet nicht unmittelbar ein. Der<br />
Patientenwille orientiert sich vermutlich in den meisten Fällen am ärztlichen<br />
Ratschlag, so dieser für vertrauenswürdig gehalten wird. Und wenn eine Ärztin in<br />
Wahrnehmung ihrer Verantwortung mit dem Blick auf das Wohl der Patientin<br />
Behandlungsoptionen darlegt und eine fundierte Empfehlung abgibt, der sie, wäre sie<br />
in der Situation der Patientin, auch folgen würde, müsste eine weitgehende<br />
Kongruenz von Patientenwohl- und Wille zu erreichen sein.<br />
105 Vgl. Klaus Dörner. 2003.<br />
106 Folgendes Beispiel mag dies illustrieren: Im Jahr 2002 entschloss sich eine erfahrene Oberärztin in<br />
einem Krankenhaus im holsteinischen Neumünster extrem frühgeborene Zwillinge nicht<br />
notfallmedizinisch zu versorgen, weil sie für die Kinder keine Entwicklungschancen jenseits einer mehr<br />
oder weniger langjährigen intensivmedizinischen Betreuung sah. Sie wurde von den Eltern verklagt,<br />
schließlich aber freigesprochen. In der Schweiz hätte ihre Entscheidung direkt auf der Linie des<br />
allgemeinen Konsenses in einem solchen Fall gestanden; in Deutschland hat eine einzelne Ärztin<br />
wenig Rückhalt für einen solchen mutigen Schritt, der eben deshalb mutig ist, weil er angreifbar ist.<br />
Vgl. DIE ZEIT 15.01.04<br />
80