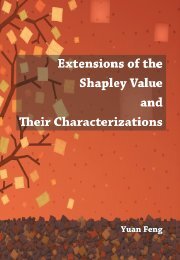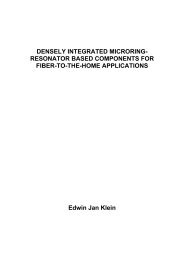WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der erste hängt damit zusammen, dass der ‚Sitz im Leben’ 112 , die kontextuelle<br />
Verankerung der Menschenrechte, nicht mehr allgemein evident ist. Das wird<br />
unmittelbar deutlich etwa am Beispiel des Rechts auf Leben. Für seine Formulierung<br />
stand in erster Linie der Wunsch nach Schutz gegen willkürliche Tötungen Pate, die<br />
im Amerika des späten achtzehnten Jahrhunderts, als dieses Recht in die Bill of<br />
rights, einem Zusatz zur amerikanischen Verfassung, aufgenommen wurde, keine<br />
Seltenheit waren. Allen war damals unmittelbar klar, vor welchen Gefahren das right<br />
to life schützen sollte. 113 Und alle teilten darin eine historische Erfahrung, die eine<br />
hinreichende Eindeutigkeit der Aussage garantierte. Heute wird das Recht auf Leben<br />
in ganz disparaten Zusammenhängen, sei es als Begründung zur Ablehnung von<br />
Abtreibungen, sei es in der Diskussion um die Fortsetzung lebenserhaltender<br />
Maßnahmen bei langjährig komatösen Patienten herangezogen. Und für diese<br />
Zusammenhänge ist es nicht wirklich gerüstet. Was bedeutet in dem einen wie dem<br />
anderen Fall körperliche Unversehrtheit, die mit dem Recht auf Leben gepaart geht?<br />
Und um wessen Unversehrtheit geht es? Ohne einen klaren Bezugsrahmen verkommt<br />
das Recht auf Leben leicht zu einer Leerformel.<br />
Das bringt uns zum zweiten Moment, das einen Bedeutungsverlust der<br />
Menschenrechte als Orientierungshilfen gerade im bioethischen Diskurs verursacht<br />
hat: ihr allzu inflationärer Gebrauch. Darauf weist vor allem Francis Fukuyama hin. Er<br />
führt aus, dass an jede technologische Novität neuerdings die Idee einer allgemeinen<br />
Zugangsberechtigung geknüpft werde. Die Rechte büßten dabei zunehmend ihren<br />
Charakter als Schutzrechte ein und würden immer mehr als Anspruchsrechte<br />
missbraucht und überdehnt. Als Beispiel spricht er das Postulat eines<br />
Fundamentalrechts auf Fortpflanzungsfreiheit an, das von dem Bioethiker John<br />
Robertson proklamiert wurde. Dieses Recht impliziert – so Robertson - einen<br />
112 Der Begriff Sitz im Leben, hat seinen Ursprung in der Theologie. Er wurde Anfang des 20.<br />
Jahrhunderts von Hermann Gunkel, Hauptvertreter der sogenannten Religionsgeschichtlichen Schule<br />
geprägt, um die spezifische Situation zu bezeichnen, in die eine bestimmte Sprachform oder<br />
Textgattung hineingehört. Im Philosophischen Kontext wird, um die Sitautionsgebundenheit der Ethik<br />
zu benennen, auf den von Lolle Nauta geprägten Begriff der exemplarischen Situation rekurriert.<br />
„Nauta zufolge hantieren Philosophen abstrakte Begriffe und Argumente immer vor dem gedanklichen<br />
Hintergrund spezifischer, in Zeit und Raum situierter Beispiele.“ (Übersetzung von mir) In: Swierstra.<br />
2004. S. 24<br />
113 „All natural rights trace home to the primary right to life, or, better, the right to self – preservation<br />
– itself rooted in the powerful, self – loving impulses and passions that seek our own continuance, and<br />
asserted first against deadly opressive polities or against those who might insist that morality requires<br />
me to turn the other cheek when my life is threatened.“ Leon Kass. 2002. S. 213<br />
87