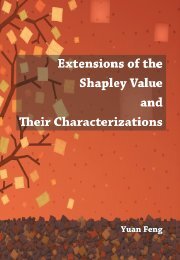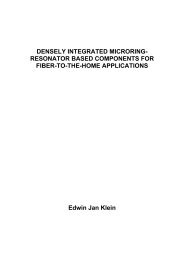WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gepaart, die den Wirkungsgrad des Jonasschen Gedankengebäudes erheblich<br />
einschränkten.<br />
Achterhuis verweist in der Hauptsache auf zwei Schwachstellen: Die erste<br />
liege, so führt er aus, darin, dass Jonas seiner profunden Analyse fast keinerlei<br />
Ansätze für praktische Konsequenzen folgen lasse. Was seine Aussagen über die<br />
kollektive Verantwortung konkret für die Lebenswirklichkeit, für die Tätigkeit von<br />
Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen bedeute, sei von ihm überhaupt nicht weiter<br />
durchdacht worden. Stattdessen habe er seine ganze Denkkraft auf eine<br />
metaphysische Grundlegung seiner Ethik konzentriert, die ihm, und hier sieht<br />
Achterhuis die zweite fundamentale Schwäche, nicht gelungen sei, wie Jonas in<br />
späteren Aufsätzen selbst konstatiere.<br />
7. Die Jonassche Metaphysik ist inkonsistent<br />
Jonas gehe in seiner metaphysisch fundierten Naturphilosophie von der<br />
Annahme einer Finalität des Weltgeschehens aus: Der Evolution wohne eine Dynamik<br />
inne, die den Entwicklungsprozess von Natur und Kultur zielgerichtet vorantreibe.<br />
Jonas nennt dies seine kosmogonische Vermutung: Die Materie wolle Geist werden.<br />
Legt man eine solche Vermutung zugrunde, müsse man eigentlich, so Achterhuis,<br />
auch die technologische Entwicklung als Teil dieses Prozesses betrachten. Denn diese<br />
entspräche den diesem Geschehen innewohnenden Kräften und Motiven. Genau an<br />
dieser Stelle aber weiche Jonas von seinen eigenen Voraussetzungen ab. Indem er<br />
auf der Bewahrung des Ebenbildes als dem Hauptziel der Zukunftsethik beharre,<br />
erkläre er den heutigen Menschen, der in der Beschreibung Jonas’ vor allem die<br />
Gestalt des westlichen Menschen bekomme, zum Endpunkt der Evolution. Diese<br />
Annahme aber entbehre, so kritisiert Achterhuis, jeglicher Grundlage. „Mit welchen<br />
Argumenten können wir behaupten, dass die Entwicklung von Wissenschaft und<br />
Technik nicht Teil der Evolution sind, wie Teilhard de Chardin (1958)<br />
meint?“ 183 (Übersetzung mk) Diese Frage drängt sich, wie schon in der Besprechung<br />
der Überlegungen Leon Kass’ ausgeführt, tatsächlich auf.<br />
183 Hans Achterhuis. 1992. S. 169<br />
130