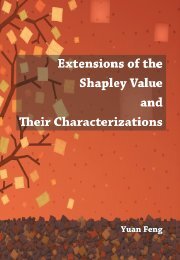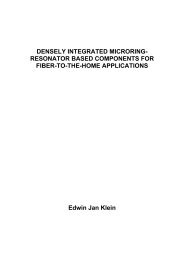WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
verehrten, in diesem Garten lebte; der ein einfaches und bescheidenes Leben pries,<br />
der ein Loblied der Lebensfreude anstimmte, der das Erstrebenswerte nach dem Maß<br />
der dadurch ermöglichten Lust beschrieb und dabei durchaus streitbar einen<br />
intellektuellen Feldzug gegen alle Irrtümer und Beschränkungen des menschlichen<br />
Geistes führte, die der Freude am Leben im Weg stehen. Dabei war Epikur ein<br />
Philosoph des Volkes. Ein Aufklärer par excellence, ein früher Entmythologisierer.<br />
Freiheit war sein Leitmotiv und er maß der Philosophie eine eminent lebensnahe<br />
Bedeutung bei. In seinem Garten lebten – eine Ungeheuerlichkeit für das damalige<br />
Athen – auch Frauen und Sklaven. Und alle, die zu ihm kamen, rief er auf,<br />
gemeinsam über das gute, gelingende Leben zu philosophieren und ihr Tun an dem,<br />
was Freude macht, auszurichten.<br />
Es wird Epikur ein sehr umfassendes Werk zugeschrieben, überliefert ist<br />
allerdings nur Weniges, das uns heute vor allem in einer Sammlung philosophischer<br />
Texte, die im dritten nachchristlichen Jahrhundert von dem Philologen Diogenes<br />
Laertius zusammengestellt wurde, zur Verfügung steht.<br />
Für Epikurs Denken und Leben waren zentral die Fragen danach, was man der<br />
Angst, sei es vor den Göttern, sei es vor Schmerzen oder Tod, entgegensetzen kann,<br />
was Leben gelingen lässt und welche Vorstellungen man sich von den<br />
metaphysischen Zusammenhängen zu machen hat. Als das Ziel menschlichen Lebens<br />
nennt Epikur die Glückseligkeit. Er schreibt, es gelte, „unseren ganzen Eifer dem<br />
zuzuwenden, was uns zur Glückseligkeit verhilft; denn haben wir sie, so haben wir<br />
alles, fehlt sie uns aber, so setzen wir alles daran, sie uns zu eigen zu machen“. 199 Er<br />
verwendet synonym die Begriffe eudaimonia bzw. makarioteta, um diesen für den<br />
Menschen so erstrebenswerten Zustand zu benennen. Konstitutiv für die<br />
Glückseligkeit sind ihm zufolge die Abwesenheit von Schmerz und ungestörte<br />
Seelenruhe, psyche ataraxia. Erläuternd führt er aus: „Liegt doch allen unseren<br />
Handlungen die Absicht zugrunde, weder Schmerz zu empfinden noch außer Fassung<br />
zu geraten.“ 200 Insofern bezeichnet die Glückseligkeit für ihn ein ganzheitliches<br />
Wohlbefinden des Körpers und der Seele. Den Göttern, so glaubt er, sei es in<br />
unveränderlicher und vollendeter Form zueigen, von Menschen in zu – und<br />
abnehmender Vervollkommnung erfahrbar.<br />
199 DL.. 1967. X.122 S. 280<br />
200 DL.. 1967. X.128 S. 282<br />
148