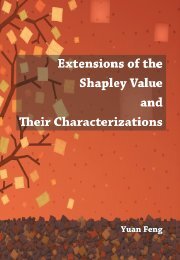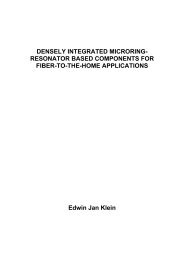WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Teil I. Informationelle Persönlichkeitsrechte und Autonomie<br />
1. Informationelle Persönlichkeitsrechte<br />
Ich beginne mit der Erläuterung der Informationellen Persönlichkeitsrechte, da<br />
– wie wir sahen - im Hinblick auf den Proteinchip vor allem der Umgang mit<br />
Informationen von Interesse ist. Das Grundrecht auf informationelle<br />
Selbstbestimmung wird als besondere Ausprägung des allgemeinen<br />
Persönlichkeitsrechts angesehen. Wie dieses wird es verfassungsrechtlich aus Art. 2<br />
Abs. 1 des Grundgesetzes, in dem es um die sogenannte allgemeine<br />
Handlungsfreiheit geht, in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes, in dem<br />
die Menschenwürde – Garantie formuliert ist, hergeleitet. 92<br />
Im Persönlichkeitsrecht ging es schon immer in besonderer Weise auch um die<br />
Reaktion auf neue Problem- und Gefährdungslagen der wissenschaftlich –<br />
technischen Entwicklung. „Dabei haben die betroffenen Rechts – und Schutzgüter<br />
einen bemerkenswert fundamentalen, aber auch etwas undeutlich diffusen Klang: Es<br />
geht um den Schutz von Personalität und Identität, Selbstbestimmung und<br />
Autonomie, um Privatheit (privacy) – und dies teilweise flankiert durch das<br />
verfassungsnormative Basiselement der Menschenwürde“. 93 Wie weiter oben bereits<br />
erwähnt, hat das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil vom 15.<br />
Dezember 1983 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Bestandteil des<br />
Grundgesetzes verabschiedet. 94<br />
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung setzt sich, wie Reinhard<br />
Damm, Professor für Zivil-, Wirtschafts- und Verfahrensrecht an der Universität<br />
Bremen, schreibt, zusammen aus den Komponenten Recht auf Wissen einerseits<br />
und Recht auf Nichtwissen andrerseits. Dies beinhalte eine gewisse Ambivalenz der<br />
Rechtspositionen, die potentiell konfliktträchtig sei: Optionsrechte, bezüglich der<br />
Inanspruchnahme von Techniken und Informationen, und Schutzrechte, bezogen auf<br />
den Schutz vor möglichen negativen Technikfolgen, träfen in dem einen Recht auf<br />
informationelle Selbstbestimmung aufeinander, seien aber im konkreten Fall<br />
92<br />
In: http://www.drehscheibe.org/ol-presserecht/olp-stichworte.html [abgerufen<br />
26.Januar 2004]<br />
93<br />
Reinhard Damm. 1999. S. 437<br />
94<br />
Vgl. S. 59 f.<br />
75