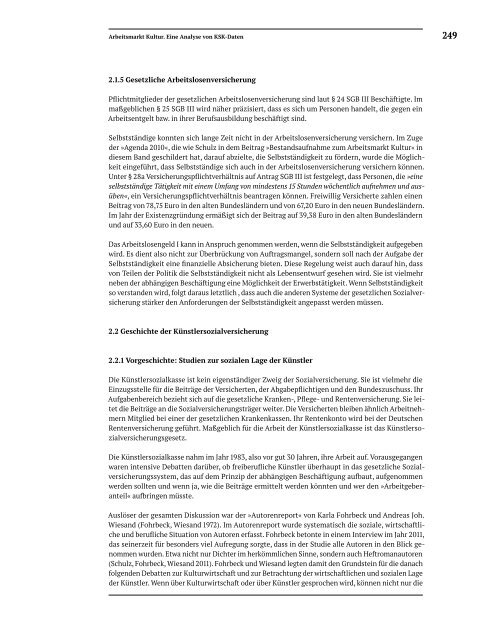Arbeitsmarkt Kultur - Deutscher Kulturrat
Arbeitsmarkt Kultur - Deutscher Kulturrat
Arbeitsmarkt Kultur - Deutscher Kulturrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>Kultur</strong>. Eine Analyse von KSK-Daten<br />
249<br />
2.1.5 Gesetzliche Arbeitslosenversicherung<br />
Pflichtmitglieder der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung sind laut § 24 SGB III Beschäftigte. Im<br />
maßgeblichen § 25 SGB III wird näher präzisiert, dass es sich um Personen handelt, die gegen ein<br />
Arbeitsentgelt bzw. in ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.<br />
Selbstständige konnten sich lange Zeit nicht in der Arbeitslosenversicherung versichern. Im Zuge<br />
der »Agenda 2010«, die wie Schulz in dem Beitrag »Bestandsaufnahme zum <strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>Kultur</strong>« in<br />
diesem Band geschildert hat, darauf abzielte, die Selbstständigkeit zu fördern, wurde die Möglichkeit<br />
eingeführt, dass Selbstständige sich auch in der Arbeitslosenversicherung versichern können.<br />
Unter § 28a Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag SGB III ist festgelegt, dass Personen, die »eine<br />
selbstständige Tätigkeit mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnehmen und ausüben«,<br />
ein Versicherungspflichtverhältnis beantragen können. Freiwillig Versicherte zahlen einen<br />
Beitrag von 78,75 Euro in den alten Bundesländern und von 67,20 Euro in den neuen Bundesländern.<br />
Im Jahr der Existenzgründung ermäßigt sich der Beitrag auf 39,38 Euro in den alten Bundesländern<br />
und auf 33,60 Euro in den neuen.<br />
Das Arbeitslosengeld I kann in Anspruch genommen werden, wenn die Selbstständigkeit aufgegeben<br />
wird. Es dient also nicht zur Überbrückung von Auftragsmangel, sondern soll nach der Aufgabe der<br />
Selbstständigkeit eine finanzielle Absicherung bieten. Diese Regelung weist auch darauf hin, dass<br />
von Teilen der Politik die Selbstständigkeit nicht als Lebensentwurf gesehen wird. Sie ist vielmehr<br />
neben der abhängigen Beschäftigung eine Möglichkeit der Erwerbstätigkeit. Wenn Selbstständigkeit<br />
so verstanden wird, folgt daraus letztlich , dass auch die anderen Systeme der gesetzlichen Sozialversicherung<br />
stärker den Anforderungen der Selbstständigkeit angepasst werden müssen.<br />
2.2 Geschichte der Künstlersozialversicherung<br />
2.2.1 Vorgeschichte: Studien zur sozialen Lage der Künstler<br />
Die Künstlersozialkasse ist kein eigenständiger Zweig der Sozialversicherung. Sie ist vielmehr die<br />
Einzugsstelle für die Beiträge der Versicherten, der Abgabepflichtigen und den Bundeszuschuss. Ihr<br />
Aufgabenbereich bezieht sich auf die gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Sie leitet<br />
die Beiträge an die Sozialversicherungsträger weiter. Die Versicherten bleiben ähnlich Arbeitnehmern<br />
Mitglied bei einer der gesetzlichen Krankenkassen. Ihr Rentenkonto wird bei der Deutschen<br />
Rentenversicherung geführt. Maßgeblich für die Arbeit der Künstlersozialkasse ist das Künstlersozialversicherungsgesetz.<br />
Die Künstlersozialkasse nahm im Jahr 1983, also vor gut 30 Jahren, ihre Arbeit auf. Vorausgegangen<br />
waren intensive Debatten darüber, ob freiberufliche Künstler überhaupt in das gesetzliche Sozialversicherungssystem,<br />
das auf dem Prinzip der abhängigen Beschäftigung aufbaut, aufgenommen<br />
werden sollten und wenn ja, wie die Beiträge ermittelt werden könnten und wer den »Arbeitgeberanteil«<br />
aufbringen müsste.<br />
Auslöser der gesamten Diskussion war der »Autorenreport« von Karla Fohrbeck und Andreas Joh.<br />
Wiesand (Fohrbeck, Wiesand 1972). Im Autorenreport wurde systematisch die soziale, wirtschaftliche<br />
und berufliche Situation von Autoren erfasst. Fohrbeck betonte in einem Interview im Jahr 2011,<br />
das seinerzeit für besonders viel Aufregung sorgte, dass in der Studie alle Autoren in den Blick genommen<br />
wurden. Etwa nicht nur Dichter im herkömmlichen Sinne, sondern auch Heftromanautoren<br />
(Schulz, Fohrbeck, Wiesand 2011). Fohrbeck und Wiesand legten damit den Grundstein für die danach<br />
folgenden Debatten zur <strong>Kultur</strong>wirtschaft und zur Betrachtung der wirtschaftlichen und sozialen Lage<br />
der Künstler. Wenn über <strong>Kultur</strong>wirtschaft oder über Künstler gesprochen wird, können nicht nur die