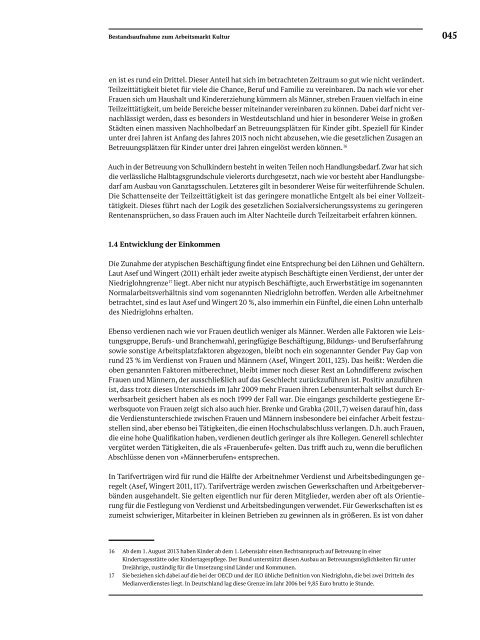Arbeitsmarkt Kultur - Deutscher Kulturrat
Arbeitsmarkt Kultur - Deutscher Kulturrat
Arbeitsmarkt Kultur - Deutscher Kulturrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bestandsaufnahme zum <strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>Kultur</strong><br />
045<br />
en ist es rund ein Drittel. Dieser Anteil hat sich im betrachteten Zeitraum so gut wie nicht verändert.<br />
Teilzeittätigkeit bietet für viele die Chance, Beruf und Familie zu vereinbaren. Da nach wie vor eher<br />
Frauen sich um Haushalt und Kindererziehung kümmern als Männer, streben Frauen vielfach in eine<br />
Teilzeittätigkeit, um beide Bereiche besser miteinander vereinbaren zu können. Dabei darf nicht vernachlässigt<br />
werden, dass es besonders in Westdeutschland und hier in besonderer Weise in großen<br />
Städten einen massiven Nachholbedarf an Betreuungsplätzen für Kinder gibt. Speziell für Kinder<br />
unter drei Jahren ist Anfang des Jahres 2013 noch nicht abzusehen, wie die gesetzlichen Zusagen an<br />
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren eingelöst werden können. 16<br />
Auch in der Betreuung von Schulkindern besteht in weiten Teilen noch Handlungsbedarf. Zwar hat sich<br />
die verlässliche Halbtagsgrundschule vielerorts durchgesetzt, nach wie vor besteht aber Handlungsbedarf<br />
am Ausbau von Ganztagsschulen. Letzteres gilt in besonderer Weise für weiterführende Schulen.<br />
Die Schattenseite der Teilzeittätigkeit ist das geringere monatliche Entgelt als bei einer Vollzeittätigkeit.<br />
Dieses führt nach der Logik des gesetzlichen Sozialversicherungssystems zu geringeren<br />
Rentenansprüchen, so dass Frauen auch im Alter Nachteile durch Teilzeitarbeit erfahren können.<br />
1.4 Entwicklung der Einkommen<br />
Die Zunahme der atypischen Beschäftigung findet eine Entsprechung bei den Löhnen und Gehältern.<br />
Laut Asef und Wingert (2011) erhält jeder zweite atypisch Beschäftigte einen Verdienst, der unter der<br />
Niedriglohngrenze 17 liegt. Aber nicht nur atypisch Beschäftigte, auch Erwerbstätige im sogenannten<br />
Normalarbeitsverhältnis sind vom sogenannten Niedriglohn betroffen. Werden alle Arbeitnehmer<br />
betrachtet, sind es laut Asef und Wingert 20 %, also immerhin ein Fünftel, die einen Lohn unterhalb<br />
des Niedriglohns erhalten.<br />
Ebenso verdienen nach wie vor Frauen deutlich weniger als Männer. Werden alle Faktoren wie Leistungsgruppe,<br />
Berufs- und Branchenwahl, geringfügige Beschäftigung, Bildungs- und Berufserfahrung<br />
sowie sonstige Arbeitsplatzfaktoren abgezogen, bleibt noch ein sogenannter Gender Pay Gap von<br />
rund 23 % im Verdienst von Frauen und Männern (Asef, Wingert 2011, 123). Das heißt: Werden die<br />
oben genannten Faktoren mitberechnet, bleibt immer noch dieser Rest an Lohndifferenz zwischen<br />
Frauen und Männern, der ausschließlich auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Positiv anzuführen<br />
ist, dass trotz dieses Unterschieds im Jahr 2009 mehr Frauen ihren Lebensunterhalt selbst durch Erwerbsarbeit<br />
gesichert haben als es noch 1999 der Fall war. Die eingangs geschilderte gestiegene Erwerbsquote<br />
von Frauen zeigt sich also auch hier. Brenke und Grabka (2011, 7) weisen darauf hin, dass<br />
die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern insbesondere bei einfacher Arbeit festzustellen<br />
sind, aber ebenso bei Tätigkeiten, die einen Hochschulabschluss verlangen. D.h. auch Frauen,<br />
die eine hohe Qualifikation haben, verdienen deutlich geringer als ihre Kollegen. Generell schlechter<br />
vergütet werden Tätigkeiten, die als »Frauenberufe« gelten. Das trifft auch zu, wenn die beruflichen<br />
Abschlüsse denen von »Männerberufen« entsprechen.<br />
In Tarifverträgen wird für rund die Hälfte der Arbeitnehmer Verdienst und Arbeitsbedingungen geregelt<br />
(Asef, Wingert 2011, 117). Tarifverträge werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden<br />
ausgehandelt. Sie gelten eigentlich nur für deren Mitglieder, werden aber oft als Orientierung<br />
für die Festlegung von Verdienst und Arbeitsbedingungen verwendet. Für Gewerkschaften ist es<br />
zumeist schwieriger, Mitarbeiter in kleinen Betrieben zu gewinnen als in größeren. Es ist von daher<br />
16 Ab dem 1. August 2013 haben Kinder ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer<br />
Kindertagesstätte oder Kindertagespflege. Der Bund unterstützt diesen Ausbau an Betreuungsmöglichkeiten für unter<br />
Drejährige, zuständig für die Umsetzung sind Länder und Kommunen.<br />
17 Sie beziehen sich dabei auf die bei der OECD und der ILO übliche Definition von Niedriglohn, die bei zwei Dritteln des<br />
Medianverdienstes liegt. In Deutschland lag diese Grenze im Jahr 2006 bei 9,85 Euro brutto je Stunde.