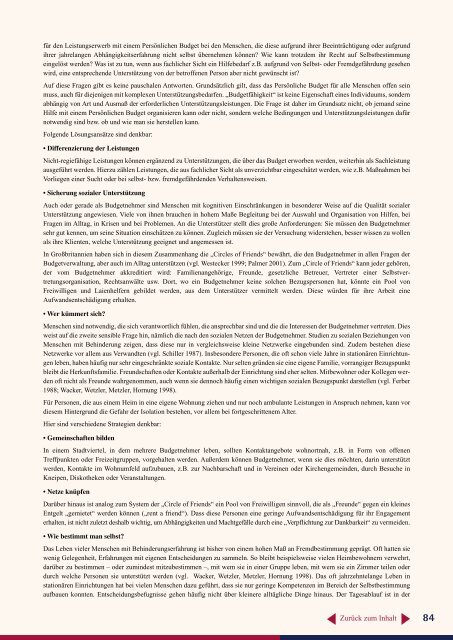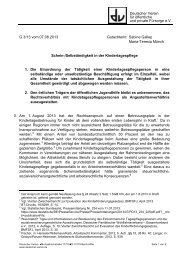Workshop 1.6 - Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Workshop 1.6 - Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Workshop 1.6 - Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>für</strong> den Leistungserwerb mit einem Persönlichen Budget bei den Menschen, die diese aufgr<strong>und</strong> ihrer Beeinträchtigung oder aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer jahrelangen Abhängigkeitserfahrung nicht selbst übernehmen können? Wie kann trotzdem ihr Recht auf Selbstbestimmung<br />
eingelöst werden? Was ist zu tun, wenn aus fachlicher Sicht ein Hilfebedarf z.B. aufgr<strong>und</strong> von Selbst- oder Fremdgefährdung gesehen<br />
wird, eine entsprechende Unterstützung von der betroffenen Person aber nicht gewünscht ist?<br />
Auf diese Fragen gibt es keine pauschalen Antworten. Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt, dass das Persönliche Budget <strong>für</strong> alle Menschen offen sein<br />
muss, auch <strong>für</strong> diejenigen mit komplexen Unterstützungsbedarfen. „Budgetfähigkeit“ ist keine Eigenschaft eines Individuums, sondern<br />
abhängig von Art <strong>und</strong> Ausmaß der erforderlichen Unterstützungsleistungen. Die Frage ist daher im Gr<strong>und</strong>satz nicht, ob jemand seine<br />
Hilfe mit einem Persönlichen Budget organisieren kann oder nicht, sondern welche Bedingungen <strong>und</strong> Unterstützungsleistungen da<strong>für</strong><br />
notwendig sind bzw. ob <strong>und</strong> wie man sie herstellen kann.<br />
Folgende Lösungsansätze sind denkbar:<br />
• Differenzierung der Leistungen<br />
Nicht-regiefähige Leistungen können ergänzend zu Unterstützungen, die über das Budget erworben werden, weiterhin als Sachleistung<br />
ausgeführt werden. Hierzu zählen Leistungen, die aus fachlicher Sicht als unverzichtbar eingeschätzt werden, wie z.B. Maßnahmen bei<br />
Vorliegen einer Sucht oder bei selbst- bzw. fremdgefährdenden Verhaltensweisen.<br />
• Sicherung sozialer Unterstützung<br />
Auch oder gerade als Budgetnehmer sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen in besonderer Weise auf die Qualität sozialer<br />
Unterstützung angewiesen. Viele von ihnen brauchen in hohem Maße Begleitung bei der Auswahl <strong>und</strong> Organisation von Hilfen, bei<br />
Fragen im Alltag, in Krisen <strong>und</strong> bei Problemen. An die Unterstützer stellt dies große Anforderungen: Sie müssen den Budgetnehmer<br />
sehr gut kennen, um seine Situation einschätzen zu können. Zugleich müssen sie der Versuchung widerstehen, besser wissen zu wollen<br />
als ihre Klienten, welche Unterstützung geeignet <strong>und</strong> angemessen ist.<br />
In Großbritannien haben sich in diesem Zusammenhang die „Circles of Friends“ bewährt, die den Budgetnehmer in allen Fragen der<br />
Budgetverwaltung, aber auch im Alltag unterstützen (vgl. Westecker 1999; Palmer 2001). Zum „Circle of Friends“ kann jeder gehören,<br />
der vom Budgetnehmer akkreditiert wird: Familienangehörige, Fre<strong>und</strong>e, gesetzliche Betreuer, Vertreter einer Selbstvertretungsorganisation,<br />
Rechtsanwälte usw. Dort, wo ein Budgetnehmer keine solchen Bezugspersonen hat, könnte ein Pool von<br />
Freiwilligen <strong>und</strong> Laienhelfern gebildet werden, aus dem Unterstützer vermittelt werden. Diese würden <strong>für</strong> ihre Arbeit eine<br />
Aufwandsentschädigung erhalten.<br />
• Wer kümmert sich?<br />
Menschen sind notwendig, die sich verantwortlich fühlen, die ansprechbar sind <strong>und</strong> die die Interessen der Budgetnehmer vertreten. Dies<br />
weist auf die zweite sensible Frage hin, nämlich die nach den sozialen Netzen der Budgetnehmer. Studien zu sozialen Beziehungen von<br />
Menschen mit Behinderung zeigen, dass diese nur in vergleichsweise kleine Netzwerke eingeb<strong>und</strong>en sind. Zudem bestehen diese<br />
Netzwerke vor allem aus Verwandten (vgl. Schiller 1987). Insbesondere Personen, die oft schon viele Jahre in stationären Einrichtungen<br />
leben, haben häufig nur sehr eingeschränkte soziale Kontakte. Nur selten gründen sie eine eigene Familie, vorrangiger Bezugspunkt<br />
bleibt die Herkunftsfamilie. Fre<strong>und</strong>schaften oder Kontakte außerhalb der Einrichtung sind eher selten. Mitbewohner oder Kollegen werden<br />
oft nicht als Fre<strong>und</strong>e wahrgenommen, auch wenn sie dennoch häufig einen wichtigen sozialen Bezugspunkt darstellen (vgl. Ferber<br />
1988; Wacker, Wetzler, Metzler, Hornung 1998).<br />
Für Personen, die aus einem Heim in eine eigene Wohnung ziehen <strong>und</strong> nur noch ambulante Leistungen in Anspruch nehmen, kann vor<br />
diesem Hintergr<strong>und</strong> die Gefahr der Isolation bestehen, vor allem bei fortgeschrittenem Alter.<br />
Hier sind verschiedene Strategien denkbar:<br />
• Gemeinschaften bilden<br />
In einem Stadtviertel, in dem mehrere Budgetnehmer leben, sollten Kontaktangebote wohnortnah, z.B. in Form von offenen<br />
Treffpunkten oder Freizeitgruppen, vorgehalten werden. Außerdem können Budgetnehmer, wenn sie dies möchten, darin unterstützt<br />
werden, Kontakte im Wohnumfeld aufzubauen, z.B. zur Nachbarschaft <strong>und</strong> in <strong>Verein</strong>en oder Kirchengemeinden, durch Besuche in<br />
Kneipen, Diskotheken oder Veranstaltungen.<br />
• Netze knüpfen<br />
Darüber hinaus ist analog zum System der „Circle of Friends“ ein Pool von Freiwilligen sinnvoll, die als „Fre<strong>und</strong>e“ gegen ein kleines<br />
Entgelt „gemietet“ werden können („rent a friend“). Dass diese Personen eine geringe Aufwandsentschädigung <strong>für</strong> ihr Engagement<br />
erhalten, ist nicht zuletzt deshalb wichtig, um Abhängigkeiten <strong>und</strong> Machtgefälle durch eine „Verpflichtung zur Dankbarkeit“ zu vermeiden.<br />
• Wie bestimmt man selbst?<br />
Das Leben vieler Menschen mit Behinderungserfahrung ist bisher von einem hohen Maß an Fremdbestimmung geprägt. Oft hatten sie<br />
wenig Gelegenheit, Erfahrungen mit eigenen Entscheidungen zu sammeln. So bleibt beispielsweise vielen Heimbewohnern verwehrt,<br />
darüber zu bestimmen – oder zumindest mitzubestimmen –, mit wem sie in einer Gruppe leben, mit wem sie ein Zimmer teilen oder<br />
durch welche Personen sie unterstützt werden (vgl. Wacker, Wetzler, Metzler, Hornung 1998). Das oft jahrzehntelange Leben in<br />
stationären Einrichtungen hat bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie nur geringe Kompetenzen im Bereich der Selbstbestimmung<br />
aufbauen konnten. Entscheidungsbefugnisse gehen häufig nicht über kleinere alltägliche Dinge hinaus. Der Tagesablauf ist in der<br />
Zurück zum Inhalt<br />
84