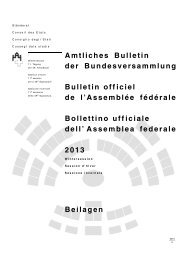Sommersession Teil 2 - Schweizer Parlament
Sommersession Teil 2 - Schweizer Parlament
Sommersession Teil 2 - Schweizer Parlament
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
83<br />
1. Wie wirken sich die Rechenschafts- und Transparenzvorschriften<br />
des Dodd-Frank-Gesetzes auf Rohstofffirmen aus, die<br />
gleichzeitig in den USA und in der Schweiz unternehmerisch<br />
tätig sind?<br />
2. Die Securities and Exchange Commission (SEC) geht davon<br />
aus, dass die Umsetzung der Dodd-Frank-Transparenzvorschriften<br />
den betroffenen Firmen Mehrkosten von bloss 12 Millionen<br />
Dollar verursacht. Mit welchen Mehrkosten wäre bei<br />
einer Umsetzung in der Schweiz zu rechnen?<br />
3. Ist er bereit, für in der Schweiz niedergelassene Rohstofffirmen<br />
vergleichbare Rechenschafts- und Transparenzvorschriften<br />
zu erlassen, wie sie die USA im Dodd-Frank-Gesetz<br />
vorsehen?<br />
4. In welcher Form wirkt der Bundesrat an der Erarbeitung entsprechender<br />
Revisionen der Transparenz- und Rechnungslegungsrichtlinien<br />
durch die Europäische Kommission mit?<br />
5. Was unternimmt er sonst, um zu vermeiden, dass die<br />
Schweiz in Bezug auf Rechenschafts- und Transparenzvorschriften<br />
das Regulationsniveau seiner wichtigsten Wirtschaftspartner<br />
unterläuft?<br />
6. Inwiefern trägt die Schweiz in der Zwischenstaatlichen<br />
Arbeitsgruppe der Uno für die Harmonisierung der nationalen<br />
Rechnungslegungs- und Revisionsvorschriften für Unternehmen<br />
(Isar) zu mehr Nachhaltigkeit und Transparenz bei?<br />
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Heim, Jans, Kiener<br />
Nellen, Nordmann, Pedrina, Schenker Silvia (7)<br />
23.11.2011 Antwort des Bundesrates.<br />
23.12.2011 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.<br />
11.3863 n Po. (Stöckli) Aubert. Ein Förderkonzept für die<br />
zeitgenössische Baukultur (28.09.2011)<br />
Der Bundesrat wird beauftragt, die Basis für ein Förderkonzept<br />
bezüglich der zeitgenössischen Architektur und der aktuellen<br />
Baukultur insgesamt zu schaffen und diese Grundlage in einem<br />
Bericht vorzulegen. Darin legt er die nötigen Daten, Eckwerte<br />
und Grundlagen dar. Der Bericht zeigt auf, welche Massnahmen<br />
im Bereich der Vermittlung, der Archivierung, der Auszeichnung<br />
und zur Förderung des Wettbewerbs im Bereich<br />
zeitgenössischer Baukultur nötig und welche finanziellen Mittel<br />
für die einzelnen Sparten zur Verfügung zu stellen sind.<br />
Im Besonderen liefert der Bericht dazu:<br />
1. eine Zusammenstellung der Mittel, welche bisher im Rahmen<br />
der Mittel für Heimatschutz und Denkmalpflege für zeitgenössische<br />
Architektur und für das aktuelle Baukulturschaffen insgesamt<br />
aufgewendet wurden, sowie eine synoptische Darstellung<br />
der Förderung und der aufgewendeten Fördermittel für Film,<br />
Literatur und Kultur im Allgemeinen (einschliesslich Pro Helvetia);<br />
2. ein repräsentatives Inventar zeitgenössischer Architektur und<br />
aktuellen Baukulturschaffens pro Kanton;<br />
3. ein Inventar der Stiftungen, Vereine, Institutionen, welche<br />
sich heute für die zeitgenössische Baukultur engagieren, inklusive<br />
deren bisheriger Finanzierung.<br />
Mitunterzeichnende: Allemann, Aubert, Bernasconi, Birrer-<br />
Heimo, Borer, Bortoluzzi, Carobbio Guscetti, Cathomas, Chopard-Acklin,<br />
Fässler Hildegard, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline,<br />
Flück Peter, Fluri, Füglistaller, Gross Andreas, Grunder,<br />
Heim, Hiltpold, Ineichen, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève,<br />
Lustenberger, Messmer, Noser, Nussbaumer, Pardini, Pedrina,<br />
Riklin Kathy, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Spuhler, Theiler,<br />
von Graffenried (34)<br />
09.12.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postulates.<br />
09.12.2011 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch<br />
Frau Aubert.<br />
11.3864 n Ip. Fehr Hans-Jürg. Wirtschaftliche Risiken der<br />
AKW (1) (28.09.2011)<br />
Atomkraftwerke sind in erster Linie wegen ihrer grossen Risiken<br />
für Mensch und Natur immer wieder ein Thema. Kaum beachtet<br />
wurden bisher die wirtschaftlichen Risiken, die ihnen anhaften.<br />
Dabei werfen sorgfältige betriebswirtschaftliche Analysen und<br />
Bilanzgutachten eine Reihe von schwerwiegenden Fragen auf.<br />
Sie betreffen insbesondere die zu schmale Kapitalbasis und die<br />
fehlende Vollkostenrechnung der Betreibergesellschaften. In<br />
beiden Mängeln können sich erhebliche finanzielle Risiken verbergen.<br />
Da die AKW den Stromkonzernen und diese wiederum<br />
den Kantonen gehören, besteht ein vitales Interesse an der<br />
Beantwortung folgender Fragen:<br />
1. Die Betriebsrechnung der AKW ist nicht in allen <strong>Teil</strong>en transparent<br />
und enthält nicht sämtliche Kosten (Vollkosten):<br />
- als direkte Folge der Unterkapitalisierung sind die Kapitalkosten<br />
zu tief angesetzt;<br />
- für den sicheren Netzbetrieb müssen für den Fall von Produktionsunterbrüchen<br />
in einzelnen Werken entsprechende Vorhalteleistungen<br />
bereitgestellt und finanziert werden. Diese Kosten<br />
werden beim Atomstrom nicht von den AKW-Betreibern getragen;<br />
- die AKW zahlen keine Gebühren für die Benützung der Übertragungsnetze<br />
bei Eigenbedarf wie etwa beim Hochpumpen<br />
von Wasser in die Speicherwerke. In einem liberalisierten Markt<br />
wird das nicht mehr möglich sein. Solche verdeckte Subventionen<br />
müssten in einer Vollkostenrechnung transparent gemacht<br />
werden.<br />
Ist der Bundesrat bereit, die AKW-Betreibergesellschaften zu<br />
einer in allen <strong>Teil</strong>en transparenten Vollkostenrechnung zu verpflichten?<br />
Wie hoch beziffert der Bundesrat die genannten indirekten<br />
Quersubventionen bei den schweizerischen AKW?<br />
2. Die Kernkraftwerke Leibstadt (KKL) und Gösgen (KKG)<br />
haben die Rechtsform von Aktiengesellschaften. Ihre Aktionäre<br />
sind schweizerische Stromkonzerne. Unabhängige Experten<br />
behaupten, diese beiden AKW seien massiv unterkapitalisiert.<br />
Allein KKL und KKG sollen 1 bis 2 Milliarden Franken Eigenkapital<br />
fehlen. Gründe sind die zu tief angesetzte Eigenkapitalquote,<br />
die nicht markt- und risikogerecht entschädigten<br />
Kapitalkosten sowie das Unterlassen der Bildung von Reserven.<br />
Zudem rechnen die AKW dem Eigenkapital die zu amortisierenden<br />
Kosten für Nachbetrieb, Stilllegung und Entsorgung<br />
als Aktiven an. Diese Aktivierung von zukünftigen Kosten ist<br />
aber fragwürdig, weil es sich dabei um fiktive Aktiven handelt.<br />
Ohne diese fiktiven Aktiven wäre die Hälfte des Aktienkapitals<br />
und der gesetzlichen Reserven nicht mehr gedeckt, und der<br />
Verwaltungsrat wäre gezwungen, unverzüglich Sanierungsmassnahmen<br />
zu ergreifen.<br />
Wie stellt sich der Bundesrat zu dieser Analyse und Argumentation?<br />
Warum wurde diese Methodik erst 2006 eingeführt und<br />
nicht schon vorher?<br />
23.11.2011 Antwort des Bundesrates.<br />
23.12.2011 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.