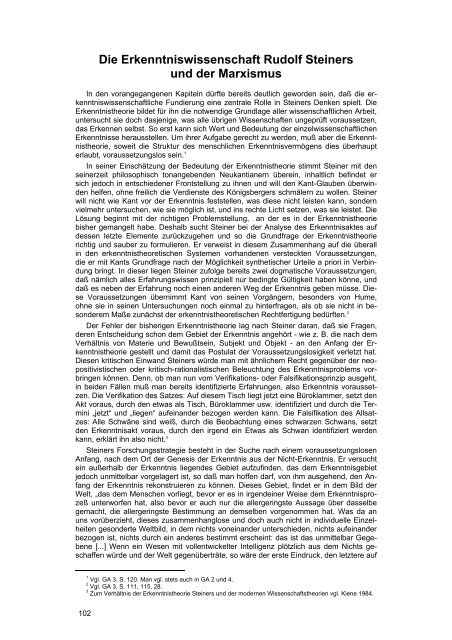Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
102<br />
Die Erkenntniswissenschaft Rudolf Steiners<br />
<strong>und</strong> der <strong>Marxismus</strong><br />
In den vorangegangenen Kapiteln dürfte bereits deutlich geworden sein, daß die erkenntniswissenschaftliche<br />
F<strong>und</strong>ierung eine zentrale Rolle in Steiners Denken spielt. Die<br />
Erkenntnistheorie bildet <strong>für</strong> ihn die notwendige Gr<strong>und</strong>lage aller wissenschaftlichen Arbeit,<br />
untersucht sie doch dasjenige, was alle übrigen Wissenschaften ungeprüft voraussetzen,<br />
das Erkennen selbst. So erst kann sich Wert <strong>und</strong> Bedeutung der einzelwissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse herausstellen. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, muß aber die Erkenntnistheorie,<br />
soweit die Struktur des menschlichen Erkenntnisvermögens dies überhaupt<br />
erlaubt, voraussetzungslos sein. 1<br />
In seiner Einschätzung der Bedeutung der Erkenntnistheorie stimmt Steiner mit den<br />
seinerzeit philosophisch tonangebenden Neukantianern überein, inhaltlich befindet er<br />
sich jedoch in entschiedener Frontstellung zu ihnen <strong>und</strong> will den Kant-Glauben überwinden<br />
helfen, ohne freilich die Verdienste des Königsbergers schmälern zu wollen. Steiner<br />
will nicht wie Kant vor der Erkenntnis feststellen, was diese nicht leisten kann, sondern<br />
vielmehr untersuchen, wie sie möglich ist, <strong>und</strong> ins rechte Licht setzen, was sie leistet. Die<br />
Lösung beginnt mit der richtigen Problemstellung, - an der es in der Erkenntnistheorie<br />
bisher gemangelt habe. Deshalb sucht Steiner bei der Analyse des Erkenntnisaktes auf<br />
dessen letzte Elemente zurückzugehen <strong>und</strong> so die Gr<strong>und</strong>frage der Erkenntnistheorie<br />
richtig <strong>und</strong> sauber zu formulieren. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die überall<br />
in den erkenntnistheoretischen Systemen vorhandenen versteckten Voraussetzungen,<br />
die er mit Kants Gr<strong>und</strong>frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori in Verbindung<br />
bringt. In dieser liegen Steiner zufolge bereits zwei dogmatische Voraussetzungen,<br />
daß nämlich alles Erfahrungswissen prinzipiell nur bedingte Gültigkeit haben könne, <strong>und</strong><br />
daß es neben der Erfahrung noch einen anderen Weg der Erkenntnis geben müsse. Diese<br />
Voraussetzungen übernimmt Kant von seinen Vorgängern, besonders von Hume,<br />
ohne sie in seinen Untersuchungen noch einmal zu hinterfragen, als ob sie nicht in besonderem<br />
Maße zunächst der erkenntnistheoretischen Rechtfertigung bedürften. 2<br />
Der Fehler der bisherigen Erkenntnistheorie lag nach Steiner daran, daß sie Fragen,<br />
deren Entscheidung schon dem Gebiet der Erkenntnis angehört - wie z. B. die nach dem<br />
Verhältnis von Materie <strong>und</strong> Bewußtsein, Subjekt <strong>und</strong> Objekt - an den Anfang der Erkenntnistheorie<br />
gestellt <strong>und</strong> damit das Postulat der Voraussetzungslosigkeit verletzt hat.<br />
Diesen kritischen Einwand Steiners würde man mit ähnlichem Recht gegenüber der neopositivistischen<br />
oder kritisch-rationalistischen Beleuchtung des Erkenntnisproblems vorbringen<br />
können. Denn, ob man nun vom Verifikations- oder Falsifikationsprinzip ausgeht,<br />
in beiden Fällen muß man bereits identifizierte Erfahrungen, also Erkenntnis voraussetzen.<br />
Die Verifikation des Satzes: Auf diesem Tisch liegt jetzt eine Büroklammer, setzt den<br />
Akt voraus, durch den etwas als Tisch, Büroklammer usw. identifiziert <strong>und</strong> durch die Termini<br />
„jetzt“ <strong>und</strong> „liegen“ aufeinander bezogen werden kann. Die Falsifikation des Allsatzes:<br />
Alle Schwäne sind weiß, durch die Beobachtung eines schwarzen Schwans, setzt<br />
den Erkenntnisakt voraus, durch den irgend ein Etwas als Schwan identifiziert werden<br />
kann, erklärt ihn also nicht. 3<br />
Steiners Forschungsstrategie besteht in der Suche nach einem voraussetzungslosen<br />
Anfang, nach dem Ort der Genesis der Erkenntnis aus der Nicht-Erkenntnis. Er versucht<br />
ein außerhalb der Erkenntnis liegendes Gebiet aufzufinden, das dem Erkenntnisgebiet<br />
jedoch unmittelbar vorgelagert ist, so daß man hoffen darf, von ihm ausgehend, den Anfang<br />
der Erkenntnis rekonstruieren zu können. Dieses Gebiet, findet er in dem Bild der<br />
Welt, „das dem Menschen vorliegt, bevor er es in irgendeiner Weise dem Erkenntnisprozeß<br />
unterworfen hat, also bevor er auch nur die allergeringste Aussage über dasselbe<br />
gemacht, die allergeringste Bestimmung an demselben vorgenommen hat. Was da an<br />
uns vorüberzieht, dieses zusammenhanglose <strong>und</strong> doch auch nicht in individuelle Einzelheiten<br />
gesonderte Weltbild, in dem nichts voneinander unterschieden, nichts aufeinander<br />
bezogen ist, nichts durch ein anderes bestimmt erscheint: das ist das unmittelbar Gegebene<br />
[...] Wenn ein Wesen mit vollentwickelter Intelligenz plötzlich aus dem Nichts geschaffen<br />
würde <strong>und</strong> der Welt gegenüberträte, so wäre der erste Eindruck, den letztere auf<br />
1 Vgl. GA 3, S. 120. Man vgl. stets auch in GA 2 <strong>und</strong> 4.<br />
2 Vgl. GA 3, S. 111, 115, 28.<br />
3 Zum Verhältnis der Erkenntnistheorie Steiners <strong>und</strong> der modernen Wissenschaftstheorien vgl. Kiene 1984.