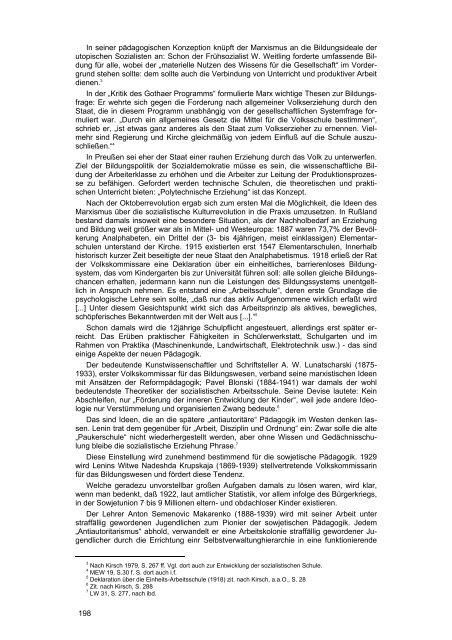Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In seiner pädagogischen Konzeption knüpft der <strong>Marxismus</strong> an die Bildungsideale der<br />
utopischen Sozialisten an: Schon der Frühsozialist W. Weitling forderte umfassende Bildung<br />
<strong>für</strong> alle, wobei der „materielle Nutzen des Wissens <strong>für</strong> die Gesellschaft“ im Vordergr<strong>und</strong><br />
stehen sollte: dem sollte auch die Verbindung von Unterricht <strong>und</strong> produktiver Arbeit<br />
dienen. 3<br />
In der „Kritik des Gothaer Programms“ formulierte Marx wichtige Thesen zur Bildungsfrage:<br />
Er wehrte sich gegen die Forderung nach allgemeiner Volkserziehung durch den<br />
Staat, die in diesem Programm unabhängig von der gesellschaftlichen Systemfrage formuliert<br />
war. „Durch ein allgemeines Gesetz die Mittel <strong>für</strong> die Volksschule bestimmen“,<br />
schrieb er, „ist etwas ganz anderes als den Staat zum Volkserzieher zu ernennen. Vielmehr<br />
sind Regierung <strong>und</strong> Kirche gleichmäßig von jedem Einfluß auf die Schule auszuschließen.“<br />
4<br />
In Preußen sei eher der Staat einer rauhen Erziehung durch das Volk zu unterwerfen.<br />
Ziel der Bildungspolitik der Sozialdemokratie müsse es sein, die wissenschaftliche Bildung<br />
der Arbeiterklasse zu erhöhen <strong>und</strong> die Arbeiter zur Leitung der Produktionsprozesse<br />
zu befähigen. Gefordert werden technische Schulen, die theoretischen <strong>und</strong> praktischen<br />
Unterricht bieten: „Polytechnische Erziehung“ ist das Konzept.<br />
Nach der Oktoberrevolution ergab sich zum ersten Mal die Möglichkeit, die Ideen des<br />
<strong>Marxismus</strong> über die sozialistische Kulturrevolution in die Praxis umzusetzen. In Rußland<br />
bestand damals insoweit eine besondere Situation, als der Nachholbedarf an Erziehung<br />
<strong>und</strong> Bildung weit größer war als in Mittel- <strong>und</strong> Westeuropa: 1887 waren 73,7% der Bevölkerung<br />
Analphabeten, ein Drittel der (3- bis 4jährigen, meist einklassigen) Elementarschulen<br />
unterstand der Kirche. 1915 existierten erst 1547 Elementarschulen, Innerhalb<br />
historisch kurzer Zeit beseitigte der neue Staat den Analphabetismus. 1918 erließ der Rat<br />
der Volkskommissare eine Deklaration über ein einheitliches, barrierenloses Bildungsystem,<br />
das vom Kindergarten bis zur Universität führen soll: alle sollen gleiche Bildungschancen<br />
erhalten, jedermann kann nun die Leistungen des Bildungssystems unentgeltlich<br />
in Anspruch nehmen. Es entstand eine „Arbeitsschule“, deren erste Gr<strong>und</strong>lage die<br />
psychologische Lehre sein sollte, „daß nur das aktiv Aufgenommene wirklich erfaßt wird<br />
[...] Unter diesem Gesichtspunkt wirkt sich das Arbeitsprinzip als aktives, bewegliches,<br />
schöpferisches Bekanntwerden mit der Welt aus [...].“ 5<br />
Schon damals wird die 12jährige Schulpflicht angesteuert, allerdings erst später erreicht.<br />
Das Erüben praktischer Fähigkeiten in Schülerwerkstatt, Schulgarten <strong>und</strong> im<br />
Rahmen von Praktika (Maschinenk<strong>und</strong>e, Landwirtschaft, Elektrotechnik usw.) - das sind<br />
einige Aspekte der neuen Pädagogik.<br />
Der bedeutende Kunstwissenschaftler <strong>und</strong> Schriftsteller A. W. Lunatscharski (1875-<br />
1933), erster Volkskommissar <strong>für</strong> das Bildungswesen, verband seine marxistischen Ideen<br />
mit Ansätzen der Reformpädagogik; Pavel Blonski (1884-1941) war damals der wohl<br />
bedeutendste Theoretiker der sozialistischen Arbeitsschule. Seine Devise lautete: Kein<br />
Abschleifen, nur „Förderung der inneren Entwicklung der Kinder“, weil jede andere Ideologie<br />
nur Verstümmelung <strong>und</strong> organisierten Zwang bedeute. 6<br />
Das sind Ideen, die an die spätere „antiautoritäre“ Pädagogik im Westen denken lassen.<br />
Lenin trat dem gegenüber <strong>für</strong> „Arbeit, Disziplin <strong>und</strong> Ordnung“ ein: Zwar solle die alte<br />
„Paukerschule“ nicht wiederhergestellt werden, aber ohne Wissen <strong>und</strong> Gedächnisschulung<br />
bleibe die sozialistische Erziehung Phrase. 7<br />
Diese Einstellung wird zunehmend bestimmend <strong>für</strong> die sowjetische Pädagogik. 1929<br />
wird Lenins Witwe Nadeshda Krupskaja (1869-1939) stellvertretende Volkskommissarin<br />
<strong>für</strong> das Bildungswesen <strong>und</strong> fördert diese Tendenz.<br />
Welche geradezu unvorstellbar großen Aufgaben damals zu lösen waren, wird klar,<br />
wenn man bedenkt, daß 1922, laut amtlicher Statistik, vor allem infolge des Bürgerkriegs,<br />
in der Sowjetunion 7 bis 9 Millionen eltern- <strong>und</strong> obdachloser Kinder existieren.<br />
Der Lehrer Anton Semenovic Makarenko (1888-1939) wird mit seiner Arbeit unter<br />
straffällig gewordenen Jugendlichen zum Pionier der sowjetischen Pädagogik. Jedem<br />
„Antiautoritarismus“ abhold, verwandelt er eine Arbeitskolonie straffällig gewordener Jugendlicher<br />
durch die Errichtung einr Selbstverwaltunghierarchie in eine funktionierende<br />
3<br />
Nach Kirsch 1979, S. 267 ff. Vgl. dort auch zur Entwicklung der sozialistischen Schule.<br />
4<br />
MEW 19, S.30 f. S. dort auch i.f.<br />
5<br />
Deklaration über die Einheits-Arbeitsschule (1918) zit. nach Kirsch, a.a.O., S. 28<br />
198<br />
6 Zit. nach Kirsch, S. 288<br />
7 LW 31, S. 277, nach ibd.