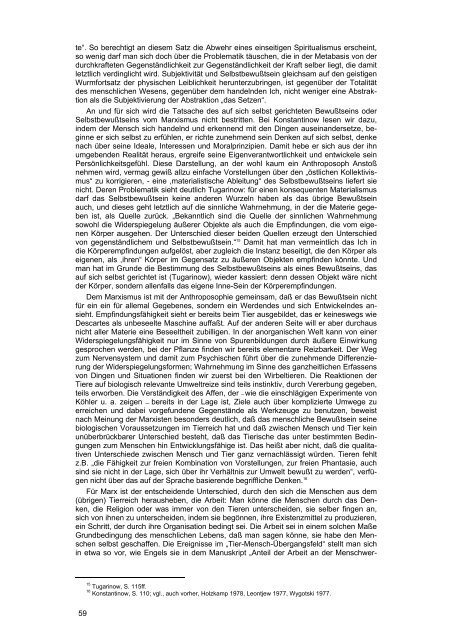Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
te“. So berechtigt an diesem Satz die Abwehr eines einseitigen Spiritualismus erscheint,<br />
so wenig darf man sich doch über die Problematik täuschen, die in der Metabasis von der<br />
durchkrafteten Gegenständlichkeit zur Gegenständlichkeit der Kraft selber liegt, die damit<br />
letztlich verdinglicht wird. Subjektivität <strong>und</strong> Selbstbewußtsein gleichsam auf den geistigen<br />
Wurmfortsatz der physischen Leiblichkeit herunterzubringen, ist gegenüber der Totalität<br />
des menschlichen Wesens, gegenüber dem handelnden Ich, nicht weniger eine Abstraktion<br />
als die Subjektivierung der Abstraktion „das Setzen“.<br />
An <strong>und</strong> <strong>für</strong> sich wird die Tatsache des auf sich selbst gerichteten Bewußtseins oder<br />
Selbstbewußtseins vom <strong>Marxismus</strong> nicht bestritten. Bei Konstantinow lesen wir dazu,<br />
indem der Mensch sich handelnd <strong>und</strong> erkennend mit den Dingen auseinandersetze, beginne<br />
er sich selbst zu erfühlen, er richte zunehmend sein Denken auf sich selbst, denke<br />
nach über seine Ideale, Interessen <strong>und</strong> Moralprinzipien. Damit hebe er sich aus der ihn<br />
umgebenden Realität heraus, ergreife seine Eigenverantwortlichkeit <strong>und</strong> entwickele sein<br />
Persönlichkeitsgefühl. Diese Darstellung, an der wohl kaum ein Anthroposoph Anstoß<br />
nehmen wird, vermag gewiß allzu einfache Vorstellungen über den „östlichen Kollektivismus“<br />
zu korrigieren, - eine ,materialistische Ableitung“ des Selbstbewußtseins liefert sie<br />
nicht. Deren Problematik sieht deutlich Tugarinow: <strong>für</strong> einen konsequenten Materialismus<br />
darf das Selbstbewußtsein keine anderen Wurzeln haben als das übrige Bewußtsein<br />
auch, <strong>und</strong> dieses geht letztlich auf die sinnliche Wahrnehmung, in der die Materie gegeben<br />
ist, als Quelle zurück. „Bekanntlich sind die Quelle der sinnlichen Wahrnehmung<br />
sowohl die Widerspiegelung äußerer Objekte als auch die Empfindungen, die vom eigenen<br />
Körper ausgehen. Der Unterschied dieser beiden Quellen erzeugt den Unterschied<br />
von gegenständlichem <strong>und</strong> Selbstbewußtsein.“ 15 Damit hat man vermeintlich das Ich in<br />
die Körperempfindungen aufgelöst, aber zugleich die Instanz beseitigt, die den Körper als<br />
eigenen, als ,ihren“ Körper im Gegensatz zu äußeren Objekten empfinden könnte. Und<br />
man hat im Gr<strong>und</strong>e die Bestimmung des Selbstbewußtseins als eines Bewußtseins, das<br />
auf sich selbst gerichtet ist (Tugarinow), wieder kassiert: denn dessen Objekt wäre nicht<br />
der Körper, sondern allenfalls das eigene Inne-Sein der Körperempfindungen.<br />
Dem <strong>Marxismus</strong> ist mit der <strong>Anthroposophie</strong> gemeinsam, daß er das Bewußtsein nicht<br />
<strong>für</strong> ein ein <strong>für</strong> allemal Gegebenes, sondern ein Werdendes <strong>und</strong> sich Entwickelndes ansieht.<br />
Empfindungsfähigkeit sieht er bereits beim Tier ausgebildet, das er keineswegs wie<br />
Descartes als unbeseelte Maschine auffaßt. Auf der anderen Seite will er aber durchaus<br />
nicht aller Materie eine Beseeltheit zubilligen. In der anorganischen Welt kann von einer<br />
Widerspiegelungsfähigkeit nur im Sinne von Spurenbildungen durch äußere Einwirkung<br />
gesprochen werden, bei der Pflanze finden wir bereits elementare Reizbarkeit. Der Weg<br />
zum Nervensystem <strong>und</strong> damit zum Psychischen führt über die zunehmende Differenzierung<br />
der Widerspiegelungsformen; Wahrnehmung im Sinne des ganzheitlichen Erfassens<br />
von Dingen <strong>und</strong> Situationen finden wir zuerst bei den Wirbeltieren. Die Reaktionen der<br />
Tiere auf biologisch relevante Umweltreize sind teils instinktiv, durch Vererbung gegeben,<br />
teils erworben. Die Verständigkeit des Affen, der — wie die einschlägigen Experimente von<br />
Köhler u. a. zeigen — bereits in der Lage ist, Ziele auch über komplizierte Umwege zu<br />
erreichen <strong>und</strong> dabei vorgef<strong>und</strong>ene Gegenstände als Werkzeuge zu benutzen, beweist<br />
nach Meinung der Marxisten besonders deutlich, daß das menschliche Bewußtsein seine<br />
biologischen Voraussetzungen im Tierreich hat <strong>und</strong> daß zwischen Mensch <strong>und</strong> Tier kein<br />
unüberbrückbarer Unterschied besteht, daß das Tierische das unter bestimmten Bedingungen<br />
zum Menschen hin Entwicklungsfähige ist. Das heißt aber nicht, daß die qualitativen<br />
Unterschiede zwischen Mensch <strong>und</strong> Tier ganz vernachlässigt würden. Tieren fehlt<br />
z.B. „die Fähigkeit zur freien Kombination von Vorstellungen, zur freien Phantasie, auch<br />
sind sie nicht in der Lage, sich über ihr Verhältnis zur Umwelt bewußt zu werden“, verfügen<br />
nicht über das auf der Sprache basierende begriffliche Denken. 16<br />
Für Marx ist der entscheidende Unterschied, durch den sich die Menschen aus dem<br />
(übrigen) Tierreich herausheben, die Arbeit: Man könne die Menschen durch das Denken,<br />
die Religion oder was immer von den Tieren unterscheiden, sie selber fingen an,<br />
sich von ihnen zu unterscheiden, indem sie begönnen, ihre Existenzmittel zu produzieren,<br />
ein Schritt, der durch ihre Organisation bedingt sei. Die Arbeit sei in einem solchen Maße<br />
Gr<strong>und</strong>bedingung des menschlichen Lebens, daß man sagen könne, sie habe den Menschen<br />
selbst geschaffen. Die Ereignisse im „Tier-Mensch-Übergangsfeld“ stellt man sich<br />
in etwa so vor, wie Engels sie in dem Manuskript „Anteil der Arbeit an der Menschwer-<br />
59<br />
15 Tugarinow, S. 115ff.<br />
16 Konstantinow, S. 110; vgl., auch vorher, Holzkamp 1978, Leontjew 1977, Wygotski 1977.