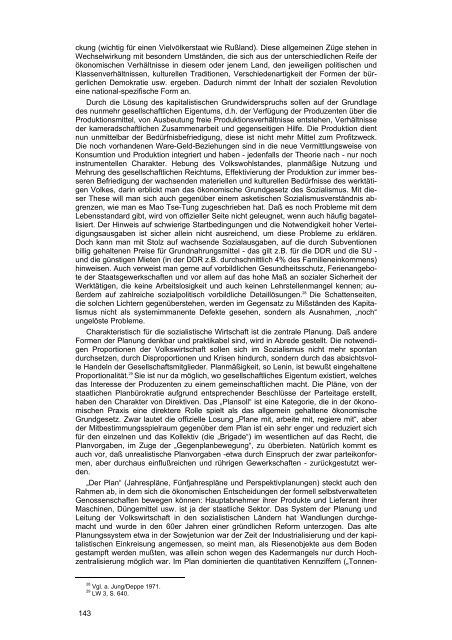Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ckung (wichtig <strong>für</strong> einen Vielvölkerstaat wie Rußland). Diese allgemeinen Züge stehen in<br />
Wechselwirkung mit besondern Umständen, die sich aus der unterschiedlichen Reife der<br />
ökonomischen Verhältnisse in diesem oder jenem Land, den jeweiligen politischen <strong>und</strong><br />
Klassenverhältnissen, kulturellen Traditionen, Verschiedenartigkeit der Formen der bürgerlichen<br />
Demokratie usw. ergeben. Dadurch nimmt der Inhalt der <strong>soziale</strong>n Revolution<br />
eine national-spezifische Form an.<br />
Durch die Lösung des kapitalistischen Gr<strong>und</strong>widerspruchs sollen auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
des nunmehr gesellschaftlichen Eigentums, d.h. der Verfügung der Produzenten über die<br />
Produktionsmittel, von Ausbeutung freie Produktionsverhältnisse entstehen, Verhältnisse<br />
der kameradschaftlichen Zusammenarbeit <strong>und</strong> gegenseitigen Hilfe. Die Produktion dient<br />
nun unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung, diese ist nicht mehr Mittel zum Profitzweck.<br />
Die noch vorhandenen Ware-Geld-Beziehungen sind in die neue Vermittlungsweise von<br />
Konsumtion <strong>und</strong> Produktion integriert <strong>und</strong> haben - jedenfalls der Theorie nach - nur noch<br />
instrumentellen Charakter. Hebung des Volkswohlstandes, planmäßige Nutzung <strong>und</strong><br />
Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums, Effektivierung der Produktion zur immer besseren<br />
Befriedigung der wachsenden materiellen <strong>und</strong> kulturellen Bedürfnisse des werktätigen<br />
Volkes, darin erblickt man das ökonomische Gr<strong>und</strong>gesetz des Sozialismus. Mit dieser<br />
These will man sich auch gegenüber einem asketischen Sozialismusverständnis abgrenzen,<br />
wie man es Mao Tse-Tung zugeschrieben hat. Daß es noch Probleme mit dem<br />
Lebensstandard gibt, wird von offizieller Seite nicht geleugnet, wenn auch häufig bagatellisiert.<br />
Der Hinweis auf schwierige Startbedingungen <strong>und</strong> die Notwendigkeit hoher Verteidigungsausgaben<br />
ist sicher allein nicht ausreichend, um diese Probleme zu erklären.<br />
Doch kann man mit Stolz auf wachsende Sozialausgaben, auf die durch Subventionen<br />
billig gehaltenen Preise <strong>für</strong> Gr<strong>und</strong>nahrungsmittel - das gilt z.B. <strong>für</strong> die DDR <strong>und</strong> die SU -<br />
<strong>und</strong> die günstigen Mieten (in der DDR z.B. durchschnittlich 4% des Familieneinkommens)<br />
hinweisen. Auch verweist man gerne auf vorbildlichen Ges<strong>und</strong>heitsschutz, Ferienangebote<br />
der Staatsgewerkschaften <strong>und</strong> vor allem auf das hohe Maß an <strong>soziale</strong>r Sicherheit der<br />
Werktätigen, die keine Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> auch keinen Lehrstellenmangel kennen; außerdem<br />
auf zahlreiche sozialpolitisch vorbildliche Detaillösungen. 28 Die Schattenseiten,<br />
die solchen Lichtern gegenüberstehen, werden im Gegensatz zu Mißständen des Kapitalismus<br />
nicht als systemimmanente Defekte gesehen, sondern als Ausnahmen, „noch“<br />
ungelöste Probleme.<br />
Charakteristisch <strong>für</strong> die sozialistische Wirtschaft ist die zentrale Planung. Daß andere<br />
Formen der Planung denkbar <strong>und</strong> praktikabel sind, wird in Abrede gestellt. Die notwendigen<br />
Proportionen der Volkswirtschaft sollen sich im Sozialismus nicht mehr spontan<br />
durchsetzen, durch Disproportionen <strong>und</strong> Krisen hindurch, sondern durch das absichtsvolle<br />
Handeln der Gesellschaftsmitglieder. Planmäßigkeit, so Lenin, ist bewußt eingehaltene<br />
Proportionalität. 29 Sie ist nur da möglich, wo gesellschaftliches Eigentum existiert, welches<br />
das Interesse der Produzenten zu einem gemeinschaftlichen macht. Die Pläne, von der<br />
staatlichen Planbürokratie aufgr<strong>und</strong> entsprechender Beschlüsse der Parteitage erstellt,<br />
haben den Charakter von Direktiven. Das „Plansoll“ ist eine Kategorie, die in der ökonomischen<br />
Praxis eine direktere Rolle spielt als das allgemein gehaltene ökonomische<br />
Gr<strong>und</strong>gesetz. Zwar lautet die offizielle Losung „Plane mit, arbeite mit, regiere mit“, aber<br />
der Mitbestimmungsspielraum gegenüber dem Plan ist ein sehr enger <strong>und</strong> reduziert sich<br />
<strong>für</strong> den einzelnen <strong>und</strong> das Kollektiv (die „Brigade“) im wesentlichen auf das Recht, die<br />
Planvorgaben, im Zuge der „Gegenplanbewegung“, zu überbieten. Natürlich kommt es<br />
auch vor, daß unrealistische Planvorgaben -etwa durch Einspruch der zwar parteikonformen,<br />
aber durchaus einflußreichen <strong>und</strong> rührigen Gewerkschaften - zurückgestutzt werden.<br />
„Der Plan“ (Jahrespläne, Fünfjahrespläne <strong>und</strong> Perspektivplanungen) steckt auch den<br />
Rahmen ab, in dem sich die ökonomischen Entscheidungen der formell selbstverwalteten<br />
Genossenschaften bewegen können: Hauptabnehmer ihrer Produkte <strong>und</strong> Lieferant ihrer<br />
Maschinen, Düngemittel usw. ist ja der staatliche Sektor. Das System der Planung <strong>und</strong><br />
Leitung der Volkswirtschaft in den sozialistischen Ländern hat Wandlungen durchgemacht<br />
<strong>und</strong> wurde in den 60er Jahren einer gründlichen Reform unterzogen. Das alte<br />
Planungssystem etwa in der Sowjetunion war der Zeit der Industrialisierung <strong>und</strong> der kapitalistischen<br />
Einkreisung angemessen, so meint man, als Riesenobjekte aus dem Boden<br />
gestampft werden mußten, was allein schon wegen des Kadermangels nur durch Hochzentralisierung<br />
möglich war. Im Plan dominierten die quantitativen Kennziffern („Tonnen-<br />
143<br />
28 Vgl. a. Jung/Deppe 1971.<br />
29 LW 3, S. 640.