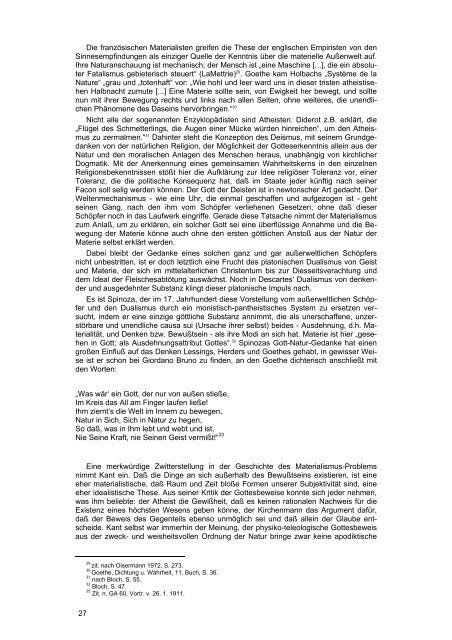Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die französischen Materialisten greifen die These der englischen Empiristen von den<br />
Sinnesempfindungen als einziger Quelle der Kenntnis über die materielle Außenwelt auf.<br />
Ihre Naturanschauung ist mechanisch; der Mensch ist „eine Maschine [...], die ein absoluter<br />
Fatalismus gebieterisch steuert“ (LaMettrie) 29 . Goethe kam Holbachs „Système de la<br />
Nature“ „grau <strong>und</strong> „totenhaft“ vor: „Wie hohl <strong>und</strong> leer ward uns in dieser tristen atheistisehen<br />
Halbnacht zumute [...] Eine Materie sollte sein, von Ewigkeit her bewegt, <strong>und</strong> sollte<br />
nun mit ihrer Bewegung rechts <strong>und</strong> links nach allen Seiten, ohne weiteres, die unendlichen<br />
Phänomene des Daseins hervorbringen.“ 30<br />
Nicht alle der sogenannten Enzyklopädisten sind Atheisten. Diderot z.B. erklärt, die<br />
„Flügel des Schmetterlings, die Augen einer Mücke würden hinreichen“, um den Atheismus<br />
zu zermalmen.“ 31 Dahinter steht die Konzeption des Deismus, mit seinem Gr<strong>und</strong>gedanken<br />
von der natürlichen Religion, der Möglichkeit der Gotteserkenntnis allein aus der<br />
Natur <strong>und</strong> den moralischen Anlagen des Menschen heraus, unabhängig von kirchlicher<br />
Dogmatik. Mit der Anerkennung eines gemeinsamen Wahrheitskerns in den einzelnen<br />
Religionsbekenntnissen stößt hier die Aufklärung zur Idee religiöser Toleranz vor, einer<br />
Toleranz, die die politische Konsequenz hat, daß im Staate jeder künftig nach seiner<br />
Facon soll selig werden können. Der Gott der Deisten ist in newtonscher Art gedacht. Der<br />
Weltenmechanismus - wie eine Uhr, die einmal geschaffen <strong>und</strong> aufgezogen ist - geht<br />
seinen Gang, nach den ihm vom Schöpfer verliehenen Gesetzen, ohne daß dieser<br />
Schöpfer noch in das Laufwerk eingriffe. Gerade diese Tatsache nimmt der Materialismus<br />
zum Anlaß, um zu erklären, ein solcher Gott sei eine überflüssige Annahme <strong>und</strong> die Bewegung<br />
der Materie könne auch ohne den ersten göttlichen Anstoß aus der Natur der<br />
Materie selbst erklärt werden.<br />
Dabei bleibt der Gedanke eines solchen ganz <strong>und</strong> gar außerweltlichen Schöpfers<br />
nicht unbestritten, ist er doch letztlich eine Frucht des platonischen Dualismus von Geist<br />
<strong>und</strong> Materie, der sich im mittelalterlichen Christentum bis zur Diesseitsverachtung <strong>und</strong><br />
dem Ideal der Fleischesabtötung auswächst. Noch in Descartes‘ Dualismus von denkender<br />
<strong>und</strong> ausgedehnter Substanz klingt dieser platonische Impuls nach.<br />
Es ist Spinoza, der im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert diese Vorstellung vom außerweltlichen Schöpfer<br />
<strong>und</strong> den Dualismus durch ein monistisch-pantheistisches System zu ersetzen versucht,<br />
indem er eine einzige göttliche Substanz annimmt, die als unerschaffene, unzerstörbare<br />
<strong>und</strong> unendliche causa sui (Ursache ihrer selbst) beides - Ausdehnung, d.h. Materialität,<br />
<strong>und</strong> Denken bzw. Bewußtsein - als ihre Modi an sich hat. Materie ist hier „gesehen<br />
in Gott; als Ausdehnungsattribut Gottes“. 32 Spinozas Gott-Natur-Gedanke hat einen<br />
großen Einfluß auf das Denken Lessings, Herders <strong>und</strong> Goethes gehabt, in gewisser Weise<br />
ist er schon bei Giordano Bruno zu finden, an den Goethe dichterisch anschließt mit<br />
den Worten:<br />
„Was wär‘ ein Gott, der nur von außen stieße,<br />
Im Kreis das All am Finger laufen ließe!<br />
Ihm ziemt‘s die Welt im Innern zu bewegen,<br />
Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen,<br />
So daß, was in Ihm lebt <strong>und</strong> webt <strong>und</strong> ist,<br />
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt!“ 33<br />
Eine merkwürdige Zwitterstellung in der Geschichte des Materialismus-Problems<br />
nimmt Kant ein. Daß die Dinge an sich außerhalb des Bewußtseins existieren, ist eine<br />
eher materialistische, daß Raum <strong>und</strong> Zeit bloße Formen unserer Subjektivität sind, eine<br />
eher idealistische These. Aus seiner Kritik der Gottesbeweise konnte sich jeder nehmen,<br />
was ihm beliebte: der Atheist die Gewißheit, daß es keinen rationalen Nachweis <strong>für</strong> die<br />
Existenz eines höchsten Wesens geben könne, der Kirchenmann das Argument da<strong>für</strong>,<br />
daß der Beweis des Gegenteils ebenso unmöglich sei <strong>und</strong> daß allein der Glaube entscheide.<br />
Kant selbst war immerhin der Meinung, der physiko-teleologische Gottesbeweis<br />
aus der zweck- <strong>und</strong> weisheitsvollen Ordnung der Natur bringe zwar keine apodiktische<br />
27<br />
29<br />
zit. nach Oisermann 1972, S. 273.<br />
30<br />
Goethe, Dichtung u. Wahrheit, 11. Buch, S. 36.<br />
31<br />
nach Bloch, S. 55.<br />
32<br />
Bloch, S. 47.<br />
33<br />
Zit. n. GA 60, Vortr. v. 26. 1. 1911.