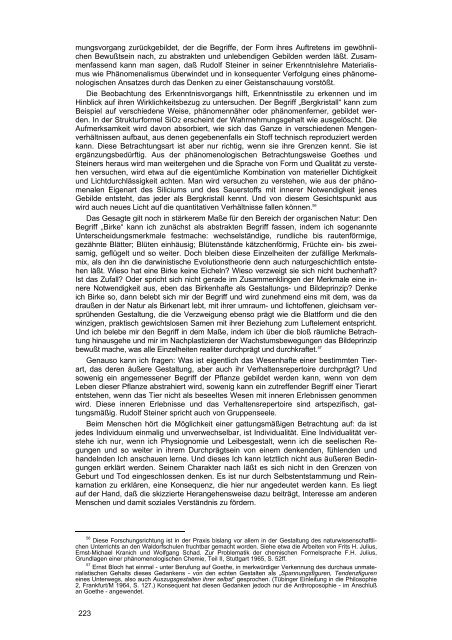Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mungsvorgang zurückgebildet, der die Begriffe, der Form ihres Auftretens im gewöhnlichen<br />
Bewußtsein nach, zu abstrakten <strong>und</strong> unlebendigen Gebilden werden läßt. Zusammenfassend<br />
kann man sagen, daß Rudolf Steiner in seiner Erkenntnislehre Materialismus<br />
wie Phänomenalismus überwindet <strong>und</strong> in konsequenter Verfolgung eines phänomenologischen<br />
Ansatzes durch das Denken zu einer Geistanschauung vorstößt.<br />
Die Beobachtung des Erkenntnisvorgangs hilft, Erkenntnisstile zu erkennen <strong>und</strong> im<br />
Hinblick auf ihren Wirklichkeitsbezug zu untersuchen. Der Begriff „Bergkristall“ kann zum<br />
Beispiel auf verschiedene Weise, phänomennäher oder phänomenferner, gebildet werden.<br />
In der Strukturformel SiO2 erscheint der Wahrnehmungsgehalt wie ausgelöscht. Die<br />
Aufmerksamkeit wird davon absorbiert, wie sich das Ganze in verschiedenen Mengenverhältnissen<br />
aufbaut, aus denen gegebenenfalls ein Stoff technisch reproduziert werden<br />
kann. Diese Betrachtungsart ist aber nur richtig, wenn sie ihre Grenzen kennt. Sie ist<br />
ergänzungsbedürftig. Aus der phänomenologischen Betrachtungsweise Goethes <strong>und</strong><br />
Steiners heraus wird man weitergehen <strong>und</strong> die Sprache von Form <strong>und</strong> Qualität zu verstehen<br />
versuchen, wird etwa auf die eigentümliche Kombination von materieller Dichtigkeit<br />
<strong>und</strong> Lichtdurchlässigkeit achten. Man wird versuchen zu verstehen, wie aus der phänomenalen<br />
Eigenart des Siliciums <strong>und</strong> des Sauerstoffs mit innerer Notwendigkeit jenes<br />
Gebilde entsteht, das jeder als Bergkristall kennt. Und von diesem Gesichtspunkt aus<br />
wird auch neues Licht auf die quantitativen Verhältnisse fallen können. 56<br />
Das Gesagte gilt noch in stärkerem Maße <strong>für</strong> den Bereich der organischen Natur: Den<br />
Begriff „Birke“ kann ich zunächst als abstrakten Begriff fassen, indem ich sogenannte<br />
Unterscheidungsmerkmale festmache: wechselständige, r<strong>und</strong>liche bis rautenförmige,<br />
gezähnte Blätter; Blüten einhäusig; Blütenstände kätzchenförmig, Früchte ein- bis zweisamig,<br />
geflügelt <strong>und</strong> so weiter. Doch bleiben diese Einzelheiten der zufällige Merkmalsmix,<br />
als den ihn die darwinistische Evolutionstheorie denn auch naturgeschichtlich entstehen<br />
läßt. Wieso hat eine Birke keine Eicheln? Wieso verzweigt sie sich nicht buchenhaft?<br />
Ist das Zufall? Oder spricht sich nicht gerade im Zusammenklingen der Merkmale eine innere<br />
Notwendigkeit aus, eben das Birkenhafte als Gestaltungs- <strong>und</strong> Bildeprinzip? Denke<br />
ich Birke so, dann belebt sich mir der Begriff <strong>und</strong> wird zunehmend eins mit dem, was da<br />
draußen in der Natur als Birkenart lebt, mit ihrer umraum- <strong>und</strong> lichtoffenen, gleichsam versprühenden<br />
Gestaltung, die die Verzweigung ebenso prägt wie die Blattform <strong>und</strong> die den<br />
winzigen, praktisch gewichtslosen Samen mit ihrer Beziehung zum Luftelement entspricht.<br />
Und ich belebe mir den Begriff in dem Maße, indem ich über die bloß räumliche Betrachtung<br />
hinausgehe <strong>und</strong> mir im Nachplastizieren der Wachstumsbewegungen das Bildeprinzip<br />
bewußt mache, was alle Einzelheiten realiter durchprägt <strong>und</strong> durchkraftet. 57<br />
Genauso kann ich fragen: Was ist eigentlich das Wesenhafte einer bestimmten Tierart,<br />
das deren äußere Gestaltung, aber auch ihr Verhaltensrepertoire durchprägt? Und<br />
sowenig ein angemessener Begriff der Pflanze gebildet werden kann, wenn von dem<br />
Leben dieser Pflanze abstrahiert wird, sowenig kann ein zutreffender Begriff einer Tierart<br />
entstehen, wenn das Tier nicht als beseeltes Wesen mit inneren Erlebnissen genommen<br />
wird. Diese inneren Erlebnisse <strong>und</strong> das Verhaltensrepertoire sind artspezifisch, gattungsmäßig.<br />
Rudolf Steiner spricht auch von Gruppenseele.<br />
Beim Menschen hört die Möglichkeit einer gattungsmäßigen Betrachtung auf: da ist<br />
jedes Individuum einmalig <strong>und</strong> unverwechselbar, ist Individualität. Eine Individualität verstehe<br />
ich nur, wenn ich Physiognomie <strong>und</strong> Leibesgestalt, wenn ich die seelischen Regungen<br />
<strong>und</strong> so weiter in ihrem Durchprägtsein von einem denkenden, fühlenden <strong>und</strong><br />
handelnden Ich anschauen lerne. Und dieses Ich kann letztlich nicht aus äußeren Bedingungen<br />
erklärt werden. Seinem Charakter nach läßt es sich nicht in den Grenzen von<br />
Geburt <strong>und</strong> Tod eingeschlossen denken. Es ist nur durch Selbstentstammung <strong>und</strong> Reinkarnation<br />
zu erklären, eine Konsequenz, die hier nur angedeutet werden kann. Es liegt<br />
auf der Hand, daß die skizzierte Herangehensweise dazu beiträgt, Interesse am anderen<br />
Menschen <strong>und</strong> damit <strong>soziale</strong>s Verständnis zu fördern.<br />
56 Diese Forschungsrichtung ist in der Praxis bislang vor allem in der Gestaltung des naturwissenschaftlichen<br />
Unterrichts an den Waldorfschulen fruchtbar gemacht worden. Siehe etwa die Arbeiten von Frits H. Julius,<br />
Ernst-Michael Kranich <strong>und</strong> Wolfgang Schad. Zur Problematik der chemischen Formelsprache F.H. Julius,<br />
Gr<strong>und</strong>lagen einer phänomenologischen Chemie, Teil II, Stuttgart 1965, S. 52ff.<br />
57 Ernst Bloch hat einmal - unter Berufung auf Goethe, in merkwürdiger Verkennung des durchaus unmaterialistischen<br />
Gehalts dieses Gedankens - von den echten Gestalten als „Spannungsfiguren, Tendenzfiguren<br />
eines Unterwegs, also auch Auszugsgestalten ihrer selbst“ gesprochen. (Tübinger Einleitung in die Philosophie<br />
2, Frankfurt/M 1964, S. 127.) Konsequent hat diesen Gedanken jedoch nur die <strong>Anthroposophie</strong> - im Anschluß<br />
an Goethe - angewendet.<br />
223