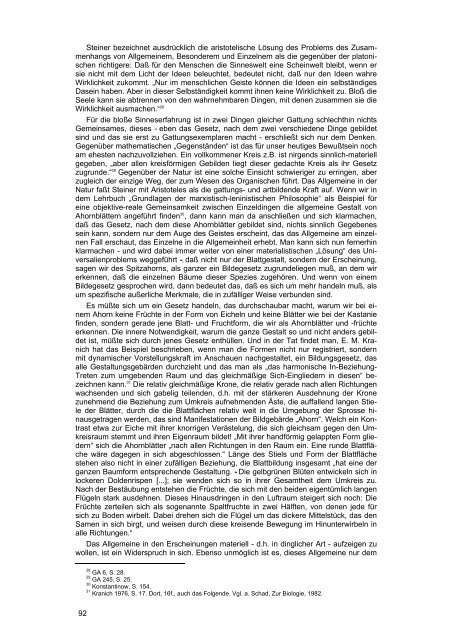Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Steiner bezeichnet ausdrücklich die aristotelische Lösung des Problems des Zusammenhangs<br />
von Allgemeinem, Besonderem <strong>und</strong> Einzelnem als die gegenüber der platonischen<br />
richtigere: Daß <strong>für</strong> den Menschen die Sinneswelt eine Scheinwelt bleibt, wenn er<br />
sie nicht mit dem Licht der Ideen beleuchtet, bedeutet nicht, daß nur den Ideen wahre<br />
Wirklichkeit zukommt. „Nur im menschlichen Geiste können die Ideen ein selbständiges<br />
Dasein haben. Aber in dieser Selbständigkeit kommt ihnen keine Wirklichkeit zu. Bloß die<br />
Seele kann sie abtrennen von den wahrnehmbaren Dingen, mit denen zusammen sie die<br />
Wirklichkeit ausmachen.“ 28<br />
Für die bloße Sinneserfahrung ist in zwei Dingen gleicher Gattung schlechthin nichts<br />
Gemeinsames, dieses - eben das Gesetz, nach dem zwei verschiedene Dinge gebildet<br />
sind <strong>und</strong> das sie erst zu Gattungsexemplaren macht - erschließt sich nur dem Denken.<br />
Gegenüber mathematischen „Gegenständen“ ist das <strong>für</strong> unser heutiges Bewußtsein noch<br />
am ehesten nachzuvollziehen. Ein vollkommener Kreis z.B. ist nirgends sinnlich-materiell<br />
gegeben, „aber allen kreisförmigen Gebilden liegt dieser gedachte Kreis als ihr Gesetz<br />
zugr<strong>und</strong>e.“ 29 Gegenüber der Natur ist eine solche Einsicht schwieriger zu erringen, aber<br />
zugleich der einzige Weg, der zum Wesen des Organischen führt. Das Allgemeine in der<br />
Natur faßt Steiner mit Aristoteles als die gattungs- <strong>und</strong> artbildende Kraft auf. Wenn wir in<br />
dem Lehrbuch „Gr<strong>und</strong>lagen der marxistisch-leninistischen Philosophie“ als Beispiel <strong>für</strong><br />
eine objektive-reale Gemeinsamkeit zwischen Einzeldingen die allgemeine Gestalt von<br />
Ahornblättern angeführt finden 30 , dann kann man da anschließen <strong>und</strong> sich klarmachen,<br />
daß das Gesetz, nach dem diese Ahornblätter gebildet sind, nichts sinnlich Gegebenes<br />
sein kann, sondern nur dem Auge des Geistes erscheint, das das Allgemeine am einzelnen<br />
Fall erschaut, das Einzelne in die Allgemeinheit erhebt. Man kann sich nun fernerhin<br />
klarmachen - <strong>und</strong> wird dabei immer weiter von einer materialistischen „Lösung“ des Universalienproblems<br />
weggeführt -, daß nicht nur der Blattgestalt, sondern der Erscheinung,<br />
sagen wir des Spitzahorns, als ganzer ein Bildegesetz zugr<strong>und</strong>eliegen muß, an dem wir<br />
erkennen, daß die einzelnen Bäume dieser Spezies zugehören. Und wenn von einem<br />
Bildegesetz gesprochen wird, dann bedeutet das, daß es sich um mehr handeln muß, als<br />
um spezifische außerliche Merkmale, die in zufälliger Weise verb<strong>und</strong>en sind.<br />
Es müßte sich um ein Gesetz handeln, das durchschaubar macht, warum wir bei einem<br />
Ahorn keine Früchte in der Form von Eicheln <strong>und</strong> keine Blätter wie bei der Kastanie<br />
finden, sondern gerade jene Blatt- <strong>und</strong> Fruchtform, die wir als Ahornblätter <strong>und</strong> -früchte<br />
erkennen. Die innere Notwendigkeit, warum die ganze Gestalt so <strong>und</strong> nicht anders gebildet<br />
ist, müßte sich durch jenes Gesetz enthüllen. Und in der Tat findet man, E. M. Kranich<br />
hat das Beispiel beschrieben, wenn man die Formen nicht nur registriert, sondern<br />
mit dynamischer Vorstellungskraft im Anschauen nachgestaltet, ein Bildungsgesetz, das<br />
alle Gestaltungsgebärden durchzieht <strong>und</strong> das man als „das harmonische In-Beziehung-<br />
Treten zum umgebenden Raum <strong>und</strong> das gleichmäßige Sich-Eingliedern in diesen“ bezeichnen<br />
kann. 31 Die relativ gleichmäßige Krone, die relativ gerade nach allen Richtungen<br />
wachsenden <strong>und</strong> sich gabelig teilenden, d.h. mit der stärkeren Ausdehnung der Krone<br />
zunehmend die Beziehung zum Umkreis aufnehmenden Äste, die auffallend langen Stiele<br />
der Blätter, durch die die Blattflächen relativ weit in die Umgebung der Sprosse hinausgetragen<br />
werden, das sind Manifestationen der Bildgebärde „Ahorn“. Welch ein Kontrast<br />
etwa zur Eiche mit ihrer knorrigen Verästelung, die sich gleichsam gegen den Umkreisraum<br />
stemmt <strong>und</strong> ihren Eigenraum bildet! „Mit ihrer handförmig gelappten Form gliedern“<br />
sich die Ahornblätter „nach allen Richtungen in den Raum ein. Eine r<strong>und</strong>e Blattfläche<br />
wäre dagegen in sich abgeschlossen.“ Länge des Stiels <strong>und</strong> Form der Blattfläche<br />
stehen also nicht in einer zufälligen Beziehung, die Blattbildung insgesamt „hat eine der<br />
ganzen Baumform entsprechende Gestaltung. - Die gelbgrünen Blüten entwickeln sich in<br />
lockeren Doldenrispen [...]; sie wenden sich so in ihrer Gesamtheit dem Umkreis zu.<br />
Nach der Bestäubung entstehen die Früchte, die sich mit den beiden eigentümlich langen<br />
Flügeln stark ausdehnen. Dieses Hinausdringen in den Luftraum steigert sich noch: Die<br />
Früchte zerteilen sich als sogenannte Spaltfruchte in zwei Hälften, von denen jede <strong>für</strong><br />
sich zu Boden wirbelt. Dabei drehen sich die Flügel um das dickere Mittelstück, das den<br />
Samen in sich birgt, <strong>und</strong> weisen durch diese kreisende Bewegung im Hinunterwirbeln in<br />
alle Richtungen.“<br />
Das Allgemeine in den Erscheinungen materiell - d.h. in dinglicher Art - aufzeigen zu<br />
wollen, ist ein Widerspruch in sich. Ebenso unmöglich ist es, dieses Allgemeine nur dem<br />
92<br />
28 GA 6, S. 28.<br />
29 GA 245, S. 25.<br />
30 Konstantinow, S. 154.<br />
31 Kranich 1976, S. 17. Dort, 16f., auch das Folgende. Vgl. a. Schad, Zur Biologie, 1982.