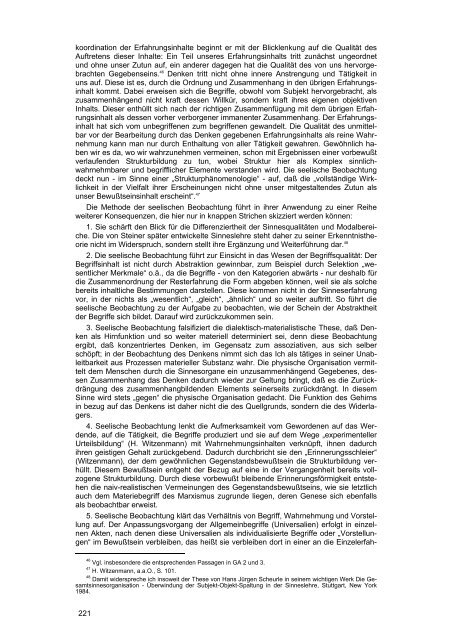Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
koordination der Erfahrungsinhalte beginnt er mit der Blicklenkung auf die Qualität des<br />
Auftretens dieser Inhalte: Ein Teil unseres Erfahrungsinhalts tritt zunächst ungeordnet<br />
<strong>und</strong> ohne unser Zutun auf, ein anderer dagegen hat die Qualität des von uns hervorgebrachten<br />
Gegebenseins. 46 Denken tritt nicht ohne innere Anstrengung <strong>und</strong> Tätigkeit in<br />
uns auf. Diese ist es, durch die Ordnung <strong>und</strong> Zusammenhang in den übrigen Erfahrungsinhalt<br />
kommt. Dabei erweisen sich die Begriffe, obwohl vom Subjekt hervorgebracht, als<br />
zusammenhängend nicht kraft dessen Willkür, sondern kraft ihres eigenen objektiven<br />
Inhalts. Dieser enthüllt sich nach der richtigen Zusammenfügung mit dem übrigen Erfahrungsinhalt<br />
als dessen vorher verborgener immanenter Zusammenhang. Der Erfahrungsinhalt<br />
hat sich vom unbegriffenen zum begriffenen gewandelt. Die Qualität des unmittelbar<br />
vor der Bearbeitung durch das Denken gegebenen Erfahrungsinhalts als reine Wahrnehmung<br />
kann man nur durch Enthaltung von aller Tätigkeit gewahren. Gewöhnlich haben<br />
wir es da, wo wir wahrzunehmen vermeinen, schon mit Ergebnissen einer vorbewußt<br />
verlaufenden Strukturbildung zu tun, wobei Struktur hier als Komplex sinnlichwahrnehmbarer<br />
<strong>und</strong> begrifflicher Elemente verstanden wird. Die seelische Beobachtung<br />
deckt nun - im Sinne einer „Strukturphänomenologie“ - auf, daß die „vollständige Wirklichkeit<br />
in der Vielfalt ihrer Erscheinungen nicht ohne unser mitgestaltendes Zutun als<br />
unser Bewußtseinsinhalt erscheint“. 47<br />
Die Methode der seelischen Beobachtung führt in ihrer Anwendung zu einer Reihe<br />
weiterer Konsequenzen, die hier nur in knappen Strichen skizziert werden können:<br />
1. Sie schärft den Blick <strong>für</strong> die Differenziertheit der Sinnesqualitäten <strong>und</strong> Modalbereiche.<br />
Die von Steiner später entwickelte Sinneslehre steht daher zu seiner Erkenntnistheorie<br />
nicht im Widerspruch, sondern stellt ihre Ergänzung <strong>und</strong> Weiterführung dar. 48<br />
2. Die seelische Beobachtung führt zur Einsicht in das Wesen der Begriffsqualität: Der<br />
Begriffsinhalt ist nicht durch Abstraktion gewinnbar, zum Beispiel durch Selektion „wesentlicher<br />
Merkmale“ o.ä., da die Begriffe - von den Kategorien abwärts - nur deshalb <strong>für</strong><br />
die Zusammenordnung der Resterfahrung die Form abgeben können, weil sie als solche<br />
bereits inhaltliche Bestimmungen darstellen. Diese kommen nicht in der Sinneserfahrung<br />
vor, in der nichts als „wesentlich“, „gleich“, „ähnlich“ <strong>und</strong> so weiter auftritt. So führt die<br />
seelische Beobachtung zu der Aufgabe zu beobachten, wie der Schein der Abstraktheit<br />
der Begriffe sich bildet. Darauf wird zurückzukommen sein.<br />
3. Seelische Beobachtung falsifiziert die dialektisch-materialistische These, daß Denken<br />
als Hirnfunktion <strong>und</strong> so weiter materiell determiniert sei, denn diese Beobachtung<br />
ergibt, daß konzentriertes Denken, im Gegensatz zum assoziativen, aus sich selber<br />
schöpft; in der Beobachtung des Denkens nimmt sich das Ich als tätiges in seiner Unableitbarkeit<br />
aus Prozessen materieller Substanz wahr. Die physische Organisation vermittelt<br />
dem Menschen durch die Sinnesorgane ein unzusammenhängend Gegebenes, dessen<br />
Zusammenhang das Denken dadurch wieder zur Geltung bringt, daß es die Zurückdrängung<br />
des zusammenhangbildenden Elements seinerseits zurückdrängt. In diesem<br />
Sinne wird stets „gegen“ die physische Organisation gedacht. Die Funktion des Gehirns<br />
in bezug auf das Denkens ist daher nicht die des Quellgr<strong>und</strong>s, sondern die des Widerlagers.<br />
4. Seelische Beobachtung lenkt die Aufmerksamkeit vom Gewordenen auf das Werdende,<br />
auf die Tätigkeit, die Begriffe produziert <strong>und</strong> sie auf dem Wege „experimenteller<br />
Urteilsbildung“ (H. Witzenmann) mit Wahrnehmungsinhalten verknüpft, ihnen dadurch<br />
ihren geistigen Gehalt zurückgebend. Dadurch durchbricht sie den „Erinnerungsschleier“<br />
(Witzenmann), der dem gewöhnlichen Gegenstandsbewußtsein die Strukturbildung verhüllt.<br />
Diesem Bewußtsein entgeht der Bezug auf eine in der Vergangenheit bereits vollzogene<br />
Strukturbildung. Durch diese vorbewußt bleibende Erinnerungsförmigkeit entstehen<br />
die naiv-realistischen Vermeinungen des Gegenstandsbewußtseins, wie sie letztlich<br />
auch dem Materiebegriff des <strong>Marxismus</strong> zugr<strong>und</strong>e liegen, deren Genese sich ebenfalls<br />
als beobachtbar erweist.<br />
5. Seelische Beobachtung klärt das Verhältnis von Begriff, Wahrnehmung <strong>und</strong> Vorstellung<br />
auf. Der Anpassungsvorgang der Allgemeinbegriffe (Universalien) erfolgt in einzelnen<br />
Akten, nach denen diese Universalien als individualisierte Begriffe oder „Vorstellungen“<br />
im Bewußtsein verbleiben, das heißt sie verbleiben dort in einer an die Einzelerfah-<br />
46<br />
Vgl. insbesondere die entsprechenden Passagen in GA 2 <strong>und</strong> 3.<br />
47<br />
H. Witzenmann, a.a.O., S. 101.<br />
48<br />
Damit widerspreche ich insoweit der These von Hans Jürgen Scheurle in seinem wichtigen Werk Die Gesamtsinnesorganisation<br />
- Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung in der Sinneslehre, Stuttgart, New York<br />
1984.<br />
221