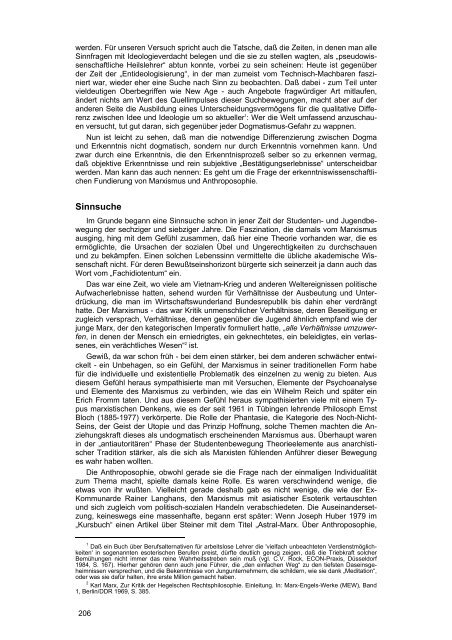Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
werden. Für unseren Versuch spricht auch die Tatsche, daß die Zeiten, in denen man alle<br />
Sinnfragen mit Ideologieverdacht belegen <strong>und</strong> die sie zu stellen wagten, als „pseudowissenschaftliche<br />
Heilslehrer“ abtun konnte, vorbei zu sein scheinen: Heute ist gegenüber<br />
der Zeit der „Entideologisierung“, in der man zumeist vom Technisch-Machbaren fasziniert<br />
war, wieder eher eine Suche nach Sinn zu beobachten. Daß dabei - zum Teil unter<br />
vieldeutigen Oberbegriffen wie New Age - auch Angebote fragwürdiger Art mitlaufen,<br />
ändert nichts am Wert des Quellimpulses dieser Suchbewegungen, macht aber auf der<br />
anderen Seite die Ausbildung eines Unterscheidungsvermögens <strong>für</strong> die qualitative Differenz<br />
zwischen Idee <strong>und</strong> Ideologie um so aktueller 1 : Wer die Welt umfassend anzuschauen<br />
versucht, tut gut daran, sich gegenüber jeder Dogmatismus-Gefahr zu wappnen.<br />
Nun ist leicht zu sehen, daß man die notwendige Differenzierung zwischen Dogma<br />
<strong>und</strong> Erkenntnis nicht dogmatisch, sondern nur durch Erkenntnis vornehmen kann. Und<br />
zwar durch eine Erkenntnis, die den Erkenntnisprozeß selber so zu erkennen vermag,<br />
daß objektive Erkenntnisse <strong>und</strong> rein subjektive „Bestätigungserlebnisse“ unterscheidbar<br />
werden. Man kann das auch nennen: Es geht um die Frage der erkenntniswissenschaftlichen<br />
F<strong>und</strong>ierung von <strong>Marxismus</strong> <strong>und</strong> <strong>Anthroposophie</strong>.<br />
Sinnsuche<br />
Im Gr<strong>und</strong>e begann eine Sinnsuche schon in jener Zeit der Studenten- <strong>und</strong> Jugendbewegung<br />
der sechziger <strong>und</strong> siebziger Jahre. Die Faszination, die damals vom <strong>Marxismus</strong><br />
ausging, hing mit dem Gefühl zusammen, daß hier eine Theorie vorhanden war, die es<br />
ermöglichte, die Ursachen der <strong>soziale</strong>n Übel <strong>und</strong> Ungerechtigkeiten zu durchschauen<br />
<strong>und</strong> zu bekämpfen. Einen solchen Lebenssinn vermittelte die übliche akademische Wissenschaft<br />
nicht. Für deren Bewußtseinshorizont bürgerte sich seinerzeit ja dann auch das<br />
Wort vom „Fachidiotentum“ ein.<br />
Das war eine Zeit, wo viele am Vietnam-Krieg <strong>und</strong> anderen Weltereignissen politische<br />
Aufwacherlebnisse hatten, sehend wurden <strong>für</strong> Verhältnisse der Ausbeutung <strong>und</strong> Unterdrückung,<br />
die man im Wirtschaftsw<strong>und</strong>erland B<strong>und</strong>esrepublik bis dahin eher verdrängt<br />
hatte. Der <strong>Marxismus</strong> - das war Kritik unmenschlicher Verhältnisse, deren Beseitigung er<br />
zugleich versprach, Verhältnisse, denen gegenüber die Jugend ähnlich empfand wie der<br />
junge Marx, der den kategorischen Imperativ formuliert hatte, „alle Verhältnisse umzuwerfen,<br />
in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein beleidigtes, ein verlassenes,<br />
ein verächtliches Wesen“ 2 ist.<br />
Gewiß, da war schon früh - bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer entwickelt<br />
- ein Unbehagen, so ein Gefühl, der <strong>Marxismus</strong> in seiner traditionellen Form habe<br />
<strong>für</strong> die individuelle <strong>und</strong> existentielle Problematik des einzelnen zu wenig zu bieten. Aus<br />
diesem Gefühl heraus sympathisierte man mit Versuchen, Elemente der Psychoanalyse<br />
<strong>und</strong> Elemente des <strong>Marxismus</strong> zu verbinden, wie das ein Wilhelm Reich <strong>und</strong> später ein<br />
Erich Fromm taten. Und aus diesem Gefühl heraus sympathisierten viele mit einem Typus<br />
marxistischen Denkens, wie es der seit 1961 in Tübingen lehrende Philosoph Ernst<br />
Bloch (1885-1977) verkörperte. Die Rolle der Phantasie, die Kategorie des Noch-Nicht-<br />
Seins, der Geist der Utopie <strong>und</strong> das Prinzip Hoffnung, solche Themen machten die Anziehungskraft<br />
dieses als <strong>und</strong>ogmatisch erscheinenden <strong>Marxismus</strong> aus. Überhaupt waren<br />
in der „antiautoritären“ Phase der Studentenbewegung Theorieelemente aus anarchistischer<br />
Tradition stärker, als die sich als Marxisten fühlenden Anführer dieser Bewegung<br />
es wahr haben wollten.<br />
Die <strong>Anthroposophie</strong>, obwohl gerade sie die Frage nach der einmaligen Individualität<br />
zum Thema macht, spielte damals keine Rolle. Es waren verschwindend wenige, die<br />
etwas von ihr wußten. Vielleicht gerade deshalb gab es nicht wenige, die wie der Ex-<br />
Kommunarde Rainer Langhans, den <strong>Marxismus</strong> mit asiatischer Esoterik vertauschten<br />
<strong>und</strong> sich zugleich vom politisch-<strong>soziale</strong>n Handeln verabschiedeten. Die Auseinandersetzung,<br />
keineswegs eine massenhafte, begann erst später: Wenn Joseph Huber 1979 im<br />
„Kursbuch“ einen Artikel über Steiner mit dem Titel „Astral-Marx. Über <strong>Anthroposophie</strong>,<br />
1 Daß ein Buch über Berufsalternativen <strong>für</strong> arbeitslose Lehrer die 'vielfach unbeachteten Verdienstmöglichkeiten'<br />
in sogenannten esoterischen Berufen preist, dürfte deutlich genug zeigen, daß die Triebkraft solcher<br />
Bemühungen nicht immer das reine Wahrheitsstreben sein muß (vgl. C.V. Rock, ECON-Praxis, Düsseldorf<br />
1984, S. 167). Hierher gehören denn auch jene Führer, die „den einfachen Weg“ zu den tiefsten Daseinsgeheimnissen<br />
versprechen, <strong>und</strong> die Bekenntnisse von Jungunternehmern, die schildern, wie sie dank „Meditation“,<br />
oder was sie da<strong>für</strong> halten, ihre erste Million gemacht haben.<br />
2 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: Marx-Engels-Werke (MEW), Band<br />
1, Berlin/DDR 1969, S. 385.<br />
206