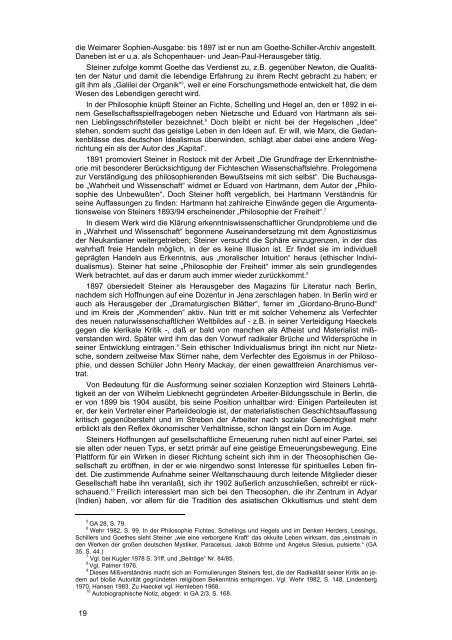Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Weimarer Sophien-Ausgabe: bis 1897 ist er nun am Goethe-Schiller-Archiv angestellt.<br />
Daneben ist er u.a. als Schopenhauer- <strong>und</strong> Jean-Paul-Herausgeber tätig.<br />
Steiner zufolge kommt Goethe das Verdienst zu, z.B. gegenüber Newton, die Qualitäten<br />
der Natur <strong>und</strong> damit die lebendige Erfahrung zu ihrem Recht gebracht zu haben; er<br />
gilt ihm als „Galilei der Organik“ 5 , weil er eine Forschungsmethode entwickelt hat, die dem<br />
Wesen des Lebendigen gerecht wird.<br />
In der Philosophie knüpft Steiner an Fichte, Schelling <strong>und</strong> Hegel an, den er 1892 in einem<br />
Gesellschaftsspielfragebogen neben Nietzsche <strong>und</strong> Eduard von Hartmann als seinen<br />
Lieblingsschriftsteller bezeichnet. 6 Doch bleibt er nicht bei der Hegelschen „Idee“<br />
stehen, sondern sucht das geistige Leben in den Ideen auf. Er will, wie Marx, die Gedankenblässe<br />
des deutschen Idealismus überwinden, schlägt aber dabei eine andere Wegrichtung<br />
ein als der Autor des „Kapital“.<br />
1891 promoviert Steiner in Rostock mit der Arbeit „Die Gr<strong>und</strong>frage der Erkenntnistheorie<br />
mit besonderer Berücksichtigung der Fichteschen Wissenschaftslehre. Prolegomena<br />
zur Verständigung des philosophierenden Bewußtseins mit sich selbst“. Die Buchausgabe<br />
„Wahrheit <strong>und</strong> Wissenschaft“ widmet er Eduard von Hartmann, dem Autor der „Philosophie<br />
des Unbewußten“. Doch Steiner hofft vergeblich, bei Hartmann Verständnis <strong>für</strong><br />
seine Auffassungen zu finden: Hartmann hat zahlreiche Einwände gegen die Argumentationsweise<br />
von Steiners 1893/94 erscheinender „Philosophie der Freiheit“. 7<br />
In diesem Werk wird die Klärung erkenntniswissenschaftlicher Gr<strong>und</strong>probleme <strong>und</strong> die<br />
in „Wahrheit <strong>und</strong> Wissenschaft“ begonnene Auseinandersetzung mit dem Agnostizismus<br />
der Neukantianer weitergetrieben; Steiner versucht die Sphäre einzugrenzen, in der das<br />
wahrhaft freie Handeln möglich, in der es keine Illusion ist. Er findet sie im individuell<br />
geprägten Handeln aus Erkenntnis, aus „moralischer Intuition“ heraus (ethischer Individualismus).<br />
Steiner hat seine „Philosophie der Freiheit“ immer als sein gr<strong>und</strong>legendes<br />
Werk betrachtet, auf das er darum auch immer wieder zurückkommt. 8<br />
1897 übersiedelt Steiner als Herausgeber des Magazins <strong>für</strong> Literatur nach Berlin,<br />
nachdem sich Hoffnungen auf eine Dozentur in Jena zerschlagen haben. In Berlin wird er<br />
auch als Herausgeber der „Dramaturgischen Blätter“, ferner im „Giordano-Bruno-B<strong>und</strong>“<br />
<strong>und</strong> im Kreis der „Kommenden“ aktiv. Nun tritt er mit solcher Vehemenz als Verfechter<br />
des neuen naturwissenschaftlichen Weltbildes auf - z.B. in seiner Verteidigung Haeckels<br />
gegen die klerikale Kritik -, daß er bald von manchen als Atheist <strong>und</strong> Materialist mißverstanden<br />
wird. Später wird ihm das den Vorwurf radikaler Brüche <strong>und</strong> Widersprüche in<br />
seiner Entwicklung eintragen. 9 Sein ethischer Individualismus bringt ihn nicht nur Nietzsche,<br />
sondern zeitweise Max Stirner nahe, dem Verfechter des Egoismus in der Philosophie,<br />
<strong>und</strong> dessen Schüler John Henry Mackay, der einen gewaltfreien Anarchismus vertrat.<br />
Von Bedeutung <strong>für</strong> die Ausformung seiner <strong>soziale</strong>n Konzeption wird Steiners Lehrtätigkeit<br />
an der von Wilhelm Liebknecht gegründeten Arbeiter-Bildungsschule in Berlin, die<br />
er von 1899 bis 1904 ausübt, bis seine Position unhaltbar wird: Einigen Parteileuten ist<br />
er, der kein Vertreter einer Parteiideologie ist, der materialistischen Geschichtsauffassung<br />
kritisch gegenübersteht <strong>und</strong> im Streben der Arbeiter nach <strong>soziale</strong>r Gerechtigkeit mehr<br />
erblickt als den Reflex ökonomischer Verhältnisse, schon längst ein Dorn im Auge.<br />
Steiners Hoffnungen auf gesellschaftliche Erneuerung ruhen nicht auf einer Partei, sei<br />
sie alten oder neuen Typs, er setzt primär auf eine geistige Erneuerungsbewegung. Eine<br />
Plattform <strong>für</strong> ein Wirken in dieser Richtung scheint sich ihm in der Theosophischen Gesellschaft<br />
zu eröffnen, in der er wie nirgendwo sonst Interesse <strong>für</strong> spirituelles Leben findet.<br />
Die zustimmende Aufnahme seiner Weltanschauung durch leitende Mitglieder dieser<br />
Gesellschaft habe ihn veranlaßt, sich ihr 1902 äußerlich anzuschließen, schreibt er rückschauend.<br />
10 Freilich interessiert man sich bei den Theosophen, die ihr Zentrum in Adyar<br />
(Indien) haben, vor allem <strong>für</strong> die Tradition des asiatischen Okkultismus <strong>und</strong> steht dem<br />
5<br />
GA 28, S. 79.<br />
6<br />
Wehr 1982, S. 99. In der Philosophie Fichtes, Schellings <strong>und</strong> Hegels <strong>und</strong> im Denken Herders, Lessings,<br />
Schillers <strong>und</strong> Goethes sieht Steiner „wie eine verborgene Kraft“ das okkulte Leben wirksam, das „einstmals in<br />
den Werken der großen deutschen Mystiker, Paracelsus, Jakob Böhme <strong>und</strong> Angelus Silesius, pulsierte.“ (GA<br />
35, S. 44.)<br />
7<br />
Vgl. bei Kugler 1978 S. 31ff. <strong>und</strong> „Beiträge“ Nr. 84/85.<br />
8<br />
Vgl. Palmer 1976.<br />
9<br />
Dieses Mißverständnis macht sich an Formulierungen Steiners fest, die der Radikalität seiner Kritik an jedem<br />
auf bloße Autorität gegründeten religiösen Bekenntnis entspringen. Vgl. Wehr 1982, S. 148, Lindenberg<br />
1970, Hansen 1983. Zu Haeckel vgl. Hemleben 1968.<br />
10<br />
Autobiographische Notiz, abgedr. in GA 2/3, S. 168.<br />
19