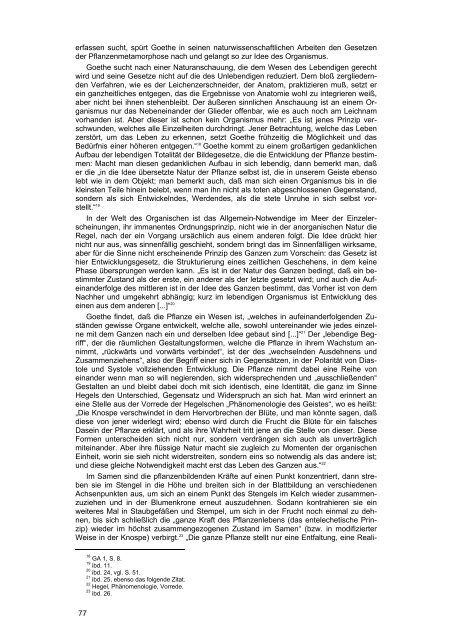Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
erfassen sucht, spürt Goethe in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten den Gesetzen<br />
der Pflanzenmetamorphose nach <strong>und</strong> gelangt so zur Idee des Organismus.<br />
Goethe sucht nach einer Naturanschauung, die dem Wesen des Lebendigen gerecht<br />
wird <strong>und</strong> seine Gesetze nicht auf die des Unlebendigen reduziert. Dem bloß zergliedernden<br />
Verfahren, wie es der Leichenzerschneider, der Anatom, praktizieren muß, setzt er<br />
ein ganzheitliches entgegen, das die Ergebnisse von Anatomie wohl zu integrieren weiß,<br />
aber nicht bei ihnen stehenbleibt. Der äußeren sinnlichen Anschauung ist an einem Organismus<br />
nur das Nebeneinander der Glieder offenbar, wie es auch noch am Leichnam<br />
vorhanden ist. Aber dieser ist schon kein Organismus mehr: „Es ist jenes Prinzip verschw<strong>und</strong>en,<br />
welches alle Einzelheiten durchdringt. Jener Betrachtung, welche das Leben<br />
zerstört, um das Leben zu erkennen, setzt Goethe frühzeitig die Möglichkeit <strong>und</strong> das<br />
Bedürfnis einer höheren entgegen.“ 18 Goethe kommt zu einem großartigen gedanklichen<br />
Aufbau der lebendigen Totalität der Bildegesetze, die die Entwicklung der Pflanze bestimmen:<br />
Macht man diesen gedanklichen Aufbau in sich lebendig, dann bemerkt man, daß<br />
er die „in die Idee übersetzte Natur der Pflanze selbst ist, die in unserem Geiste ebenso<br />
lebt wie in dem Objekt; man bemerkt auch, daß man sich einen Organismus bis in die<br />
kleinsten Teile hinein belebt, wenn man ihn nicht als toten abgeschlossenen Gegenstand,<br />
sondern als sich Entwickelndes, Werdendes, als die stete Unruhe in sich selbst vorstellt.“<br />
19<br />
In der Welt des Organischen ist das Allgemein-Notwendige im Meer der Einzelerscheinungen,<br />
ihr immanentes Ordnungsprinzip, nicht wie in der anorganischen Natur die<br />
Regel, nach der ein Vorgang ursächlich aus einem anderen folgt. Die Idee drückt hier<br />
nicht nur aus, was sinnenfällig geschieht, sondern bringt das im Sinnenfälligen wirksame,<br />
aber <strong>für</strong> die Sinne nicht erscheinende Prinzip des Ganzen zum Vorschein: das Gesetz ist<br />
hier Entwicklungsgesetz, die Strukturierung eines zeitlichen Geschehens, in dem keine<br />
Phase übersprungen werden kann. „Es ist in der Natur des Ganzen bedingt, daß ein bestimmter<br />
Zustand als der erste, ein anderer als der letzte gesetzt wird; <strong>und</strong> auch die Aufeinanderfolge<br />
des mittleren ist in der Idee des Ganzen bestimmt, das Vorher ist von dem<br />
Nachher <strong>und</strong> umgekehrt abhängig; kurz im lebendigen Organismus ist Entwicklung des<br />
einen aus dem anderen [...]“ 20<br />
Goethe findet, daß die Pflanze ein Wesen ist, „welches in aufeinanderfolgenden Zuständen<br />
gewisse Organe entwickelt, welche alle, sowohl untereinander wie jedes einzelne<br />
mit dem Ganzen nach ein <strong>und</strong> derselben Idee gebaut sind [...]“ 21 Der „lebendige Begriff“,<br />
der die räumlichen Gestaltungsformen, welche die Pflanze in ihrem Wachstum annimmt,<br />
„rückwärts <strong>und</strong> vorwärts verbindet“, ist der des „wechselnden Ausdehnens <strong>und</strong><br />
Zusammenziehens“, also der Begriff einer sich in Gegensätzen, in der Polarität von Diastole<br />
<strong>und</strong> Systole vollziehenden Entwicklung. Die Pflanze nimmt dabei eine Reihe von<br />
einander wenn man so will negierenden, sich widersprechenden <strong>und</strong> „ausschließenden“<br />
Gestalten an <strong>und</strong> bleibt dabei doch mit sich identisch, eine Identität, die ganz im Sinne<br />
Hegels den Unterschied, Gegensatz <strong>und</strong> Widerspruch an sich hat. Man wird erinnert an<br />
eine Stelle aus der Vorrede der Hegelschen „Phänomenologie des Geistes“, wo es heißt:<br />
„Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte, <strong>und</strong> man könnte sagen, daß<br />
diese von jener widerlegt wird; ebenso wird durch die Frucht die Blüte <strong>für</strong> ein falsches<br />
Dasein der Pflanze erklärt, <strong>und</strong> als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese<br />
Formen unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich<br />
miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen<br />
Einheit, worin sie sieh nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist;<br />
<strong>und</strong> diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus.“ 22<br />
Im Samen sind die pflanzenbildenden Kräfte auf einen Punkt konzentriert, dann streben<br />
sie im Stengel in die Höhe <strong>und</strong> breiten sich in der Blattbildung an verschiedenen<br />
Achsenpunkten aus, um sich an einem Punkt des Stengels im Kelch wieder zusammenzuziehen<br />
<strong>und</strong> in der Blumenkrone erneut auszudehnen. Sodann kontrahieren sie ein<br />
weiteres Mal in Staubgefäßen <strong>und</strong> Stempel, um sich in der Frucht noch einmal zu dehnen,<br />
bis sich schließlich die „ganze Kraft des Pflanzenlebens (das entelechetische Prinzip)<br />
wieder im höchst zusammengezogenen Zustand im Samen“ (bzw. in modifizierter<br />
Weise in der Knospe) verbirgt. 23 „Die ganze Pflanze stellt nur eine Entfaltung, eine Reali-<br />
77<br />
18<br />
GA 1, S. 8.<br />
19<br />
ibd. 11.<br />
20<br />
ibd. 24, vgl. S. 51.<br />
21<br />
ibd. 25, ebenso das folgende Zitat.<br />
22<br />
Hegel, Phänomenologie, Vorrede.<br />
23<br />
ibd. 26.