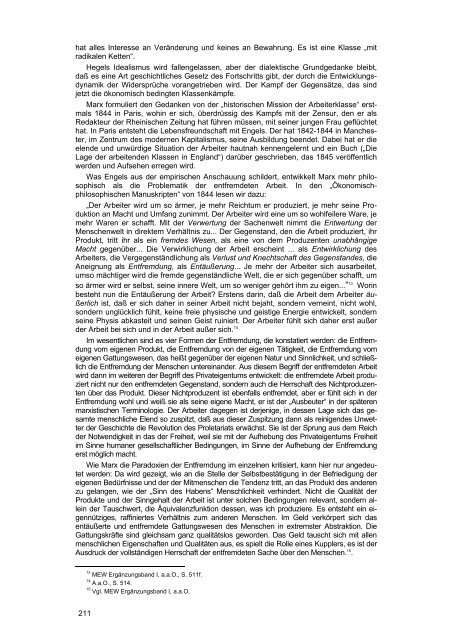Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
hat alles Interesse an Veränderung <strong>und</strong> keines an Bewahrung. Es ist eine Klasse „mit<br />
radikalen Ketten“.<br />
Hegels Idealismus wird fallengelassen, aber der dialektische Gr<strong>und</strong>gedanke bleibt,<br />
daß es eine Art geschichtliches Gesetz des Fortschritts gibt, der durch die Entwicklungsdynamik<br />
der Widersprüche vorangetrieben wird. Der Kampf der Gegensätze, das sind<br />
jetzt die ökonomisch bedingten Klassenkämpfe.<br />
Marx formuliert den Gedanken von der „historischen Mission der Arbeiterklasse“ erstmals<br />
1844 in Paris, wohin er sich, überdrüssig des Kampfs mit der Zensur, den er als<br />
Redakteur der Rheinischen Zeitung hat führen müssen, mit seiner jungen Frau geflüchtet<br />
hat. In Paris entsteht die Lebensfre<strong>und</strong>schaft mit Engels. Der hat 1842-1844 in Manchester,<br />
im Zentrum des modernen Kapitalismus, seine Ausbildung beendet. Dabei hat er die<br />
elende <strong>und</strong> unwürdige Situation der Arbeiter hautnah kennengelernt <strong>und</strong> ein Buch („Die<br />
Lage der arbeitenden Klassen in England“) darüber geschrieben, das 1845 veröffentlich<br />
werden <strong>und</strong> Aufsehen erregen wird.<br />
Was Engels aus der empirischen Anschauung schildert, entwikkelt Marx mehr philosophisch<br />
als die Problematik der entfremdeten Arbeit. In den „Ökonomischphilosophischen<br />
Manuskripten“ von 1844 lesen wir dazu:<br />
„Der Arbeiter wird um so ärmer, je mehr Reichtum er produziert, je mehr seine Produktion<br />
an Macht <strong>und</strong> Umfang zunimmt. Der Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Ware, je<br />
mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der<br />
Menschenwelt in direktem Verhältnis zu... Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr<br />
Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine von dem Produzenten unabhängige<br />
Macht gegenüber... Die Verwirklichung der Arbeit erscheint ... als Entwirklichung des<br />
Arbeiters, die Vergegenständlichung als Verlust <strong>und</strong> Knechtschaft des Gegenstandes, die<br />
Aneignung als Entfremdung, als Entäußerung... Je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet,<br />
umso mächtiger wird die fremde gegenständliche Welt, die er sich gegenüber schafft, um<br />
so ärmer wird er selbst, seine innere Welt, um so weniger gehört ihm zu eigen...“ 13 Worin<br />
besteht nun die Entäußerung der Arbeit? Erstens darin, daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich<br />
ist, daß er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl,<br />
sondern unglücklich fühlt, keine freie physische <strong>und</strong> geistige Energie entwickelt, sondern<br />
seine Physis abkasteit <strong>und</strong> seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer<br />
der Arbeit bei sich <strong>und</strong> in der Arbeit außer sich. 14<br />
Im wesentlichen sind es vier Formen der Entfremdung, die konstatiert werden: die Entfremdung<br />
vom eigenen Produkt, die Entfremdung von der eigenen Tätigkeit, die Entfremdung vom<br />
eigenen Gattungswesen, das heißt gegenüber der eigenen Natur <strong>und</strong> Sinnlichkeit, <strong>und</strong> schließlich<br />
die Entfremdung der Menschen untereinander. Aus diesem Begriff der entfremdeten Arbeit<br />
wird dann im weiteren der Begriff des Privateigentums entwickelt: die entfremdete Arbeit produziert<br />
nicht nur den entfremdeten Gegenstand, sondern auch die Herrschaft des Nichtproduzenten<br />
über das Produkt. Dieser Nichtproduzent ist ebenfalls entfremdet, aber er fühlt sich in der<br />
Entfremdung wohl <strong>und</strong> weiß sie als seine eigene Macht, er ist der „Ausbeuter“ in der späteren<br />
marxistischen Terminologie. Der Arbeiter dagegen ist derjenige, in dessen Lage sich das gesamte<br />
menschliche Elend so zuspitzt, daß aus dieser Zuspitzung dann als reinigendes Unwetter<br />
der Geschichte die Revolution des Proletariats erwächst. Sie ist der Sprung aus dem Reich<br />
der Notwendigkeit in das der Freiheit, weil sie mit der Aufhebung des Privateigentums Freiheit<br />
im Sinne humaner gesellschaftlicher Bedingungen, im Sinne der Aufhebung der Entfremdung<br />
erst möglich macht.<br />
Wie Marx die Paradoxien der Entfremdung im einzelnen kritisiert, kann hier nur angedeutet<br />
werden: Da wird gezeigt, wie an die Stelle der Selbstbestätigung in der Befriedigung der<br />
eigenen Bedürfnisse <strong>und</strong> der der Mitmenschen die Tendenz tritt, an das Produkt des anderen<br />
zu gelangen, wie der „Sinn des Habens“ Menschlichkeit verhindert. Nicht die Qualität der<br />
Produkte <strong>und</strong> der Sinngehalt der Arbeit ist unter solchen Bedingungen relevant, sondern allein<br />
der Tauschwert, die Äquivalenzfunktion dessen, was ich produziere. Es entsteht ein eigennütziges,<br />
raffiniertes Verhältnis zum anderen Menschen. Im Geld verkörpert sich das<br />
entäußerte <strong>und</strong> entfremdete Gattungswesen des Menschen in extremster Abstraktion. Die<br />
Gattungskräfte sind gleichsam ganz qualitätslos geworden. Das Geld tauscht sich mit allen<br />
menschlichen Eigenschaften <strong>und</strong> Qualitäten aus, es spielt die Rolle eines Kupplers, es ist der<br />
Ausdruck der vollständigen Herrschaft der entfremdeten Sache über den Menschen. 15 .<br />
13<br />
MEW Ergänzungsband I, a.a.O., S. 511f.<br />
14<br />
A.a.O., S. 514.<br />
15<br />
Vgl. MEW Ergänzungsband I, a.a.O.<br />
211