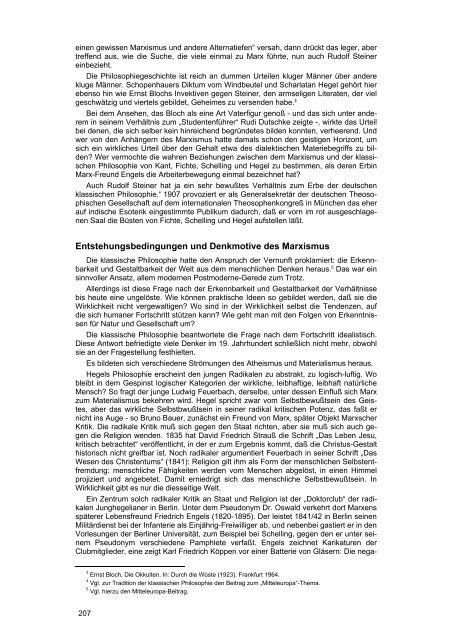Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
einen gewissen <strong>Marxismus</strong> <strong>und</strong> andere Alternatiefen“ versah, dann drückt das leger, aber<br />
treffend aus, wie die Suche, die viele einmal zu Marx führte, nun auch Rudolf Steiner<br />
einbezieht.<br />
Die Philosophiegeschichte ist reich an dummen Urteilen kluger Männer über andere<br />
kluge Männer. Schopenhauers Diktum vom Windbeutel <strong>und</strong> Scharlatan Hegel gehört hier<br />
ebenso hin wie Ernst Blochs Invektiven gegen Steiner, den armseligen Literaten, der viel<br />
geschwätzig <strong>und</strong> viertels gebildet, Geheimes zu versenden habe. 3<br />
Bei dem Ansehen, das Bloch als eine Art Vaterfigur genoß - <strong>und</strong> das sich unter anderem<br />
in seinem Verhältnis zum „Studentenführer“ Rudi Dutschke zeigte -, wirkte das Urteil<br />
bei denen, die sich selber kein hinreichend begründetes bilden konnten, verheerend. Und<br />
wer von den Anhängern des <strong>Marxismus</strong> hatte damals schon den geistigen Horizont, um<br />
sich ein wirkliches Urteil über den Gehalt etwa des dialektischen Materiebegriffs zu bilden?<br />
Wer vermochte die wahren Beziehungen zwischen dem <strong>Marxismus</strong> <strong>und</strong> der klassischen<br />
Philosophie von Kant, Fichte, Schelling <strong>und</strong> Hegel zu bestimmen, als deren Erbin<br />
Marx-Fre<strong>und</strong> Engels die Arbeiterbewegung einmal bezeichnet hat?<br />
Auch Rudolf Steiner hat ja ein sehr bewußtes Verhältnis zum Erbe der deutschen<br />
klassischen Philosophie. 4 1907 provoziert er als Generalsekretär der deutschen Theosophischen<br />
Gesellschaft auf dem internationalen Theosophenkongreß in München das eher<br />
auf indische Esoterik eingestimmte Publikum dadurch, daß er vorn im rot ausgeschlagenen<br />
Saal die Büsten von Fichte, Schelling <strong>und</strong> Hegel aufstellen läßt.<br />
Entstehungsbedingungen <strong>und</strong> Denkmotive des <strong>Marxismus</strong><br />
Die klassische Philosophie hatte den Anspruch der Vernunft proklamiert: die Erkennbarkeit<br />
<strong>und</strong> Gestaltbarkeit der Welt aus dem menschlichen Denken heraus. 5 Das war ein<br />
sinnvoller Ansatz, allem modernen Postmoderne-Gerede zum Trotz.<br />
Allerdings ist diese Frage nach der Erkennbarkeit <strong>und</strong> Gestaltbarkeit der Verhältnisse<br />
bis heute eine ungelöste. Wie können praktische Ideen so gebildet werden, daß sie die<br />
Wirklichkeit nicht vergewaltigen? Wo sind in der Wirklichkeit selbst die Tendenzen, auf<br />
die sich humaner Fortschritt stützen kann? Wie geht man mit den Folgen von Erkenntnissen<br />
<strong>für</strong> Natur <strong>und</strong> Gesellschaft um?<br />
Die klassische Philosophie beantwortete die Frage nach dem Fortschritt idealistisch.<br />
Diese Antwort befriedigte viele Denker im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert schließlich nicht mehr, obwohl<br />
sie an der Fragestellung festhielten.<br />
Es bildeten sich verschiedene Strömungen des Atheismus <strong>und</strong> Materialismus heraus.<br />
Hegels Philosophie erscheint den jungen Radikalen zu abstrakt, zu logisch-luftig. Wo<br />
bleibt in dem Gespinst logischer Kategorien der wirkliche, leibhaftige, leibhaft natürliche<br />
Mensch? So fragt der junge Ludwig Feuerbach, derselbe, unter dessen Einfluß sich Marx<br />
zum Materialismus bekehren wird. Hegel spricht zwar vom Selbstbewußtsein des Geistes,<br />
aber das wirkliche Selbstbwußtsein in seiner radikal kritischen Potenz, das faßt er<br />
nicht ins Auge - so Bruno Bauer, zunächst ein Fre<strong>und</strong> von Marx, später Objekt Marxscher<br />
Kritik. Die radikale Kritik muß sich gegen den Staat richten, aber sie muß sich auch gegen<br />
die Religion wenden. 1835 hat David Friedrich Strauß die Schrift „Das Leben Jesu,<br />
kritisch betrachtet“ veröffentlicht, in der er zum Ergebnis kommt, daß die Christus-Gestalt<br />
historisch nicht greifbar ist. Noch radikaler argumentiert Feuerbach in seiner Schrift „Das<br />
Wesen des Christentums“ (1841): Religion gilt ihm als Form der menschlichen Selbstentfremdung:<br />
menschliche Fähigkeiten werden vom Menschen abgelöst, in einen Himmel<br />
projiziert <strong>und</strong> angebetet. Damit erniedrigt sich das menschliche Selbstbewußtsein. In<br />
Wirklichkeit gibt es nur die diesseitige Welt.<br />
Ein Zentrum solch radikaler Kritik an Staat <strong>und</strong> Religion ist der „Doktorclub“ der radikalen<br />
Junghegelianer in Berlin. Unter dem Pseudonym Dr. Oswald verkehrt dort Marxens<br />
späterer Lebensfre<strong>und</strong> Friedrich Engels (1820-1895). Der leistet 1841/42 in Berlin seinen<br />
Militärdienst bei der Infanterie als Einjährig-Freiwilliger ab, <strong>und</strong> nebenbei gastiert er in den<br />
Vorlesungen der Berliner Universität, zum Beispiel bei Schelling, gegen den er unter seinem<br />
Pseudonym verschiedene Pamphlete verfaßt. Engels zeichnet Karikaturen der<br />
Clubmitglieder, eine zeigt Karl Friedrich Köppen vor einer Batterie von Gläsern: Die nega-<br />
207<br />
3 Ernst Bloch, Die Okkulten. In: Durch die Wüste (1923). Frankfurt 1964.<br />
4 Vgl. zur Tradition der klassischen Philosophie den Beitrag zum „Mitteleuropa“-Thema.<br />
5 Vgl. hierzu den Mitteleuropa-Beitrag.