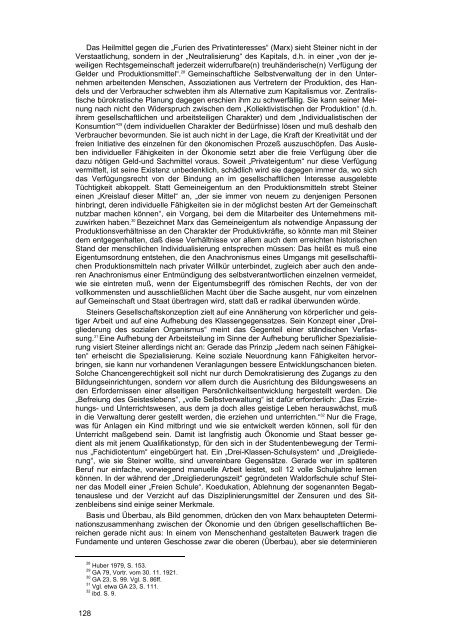Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Heilmittel gegen die „Furien des Privatinteresses“ (Marx) sieht Steiner nicht in der<br />
Verstaatlichung, sondern in der „Neutralisierung“ des Kapitals, d.h. in einer „von der jeweiligen<br />
Rechtsgemeinschaft jederzeit widerrufbare(n) treuhänderische(n) Verfügung der<br />
Gelder <strong>und</strong> Produktionsmittel“. 28 Gemeinschaftliche Selbstverwaltung der in den Unternehmen<br />
arbeitenden Menschen, Assoziationen aus Vertretern der Produktion, des Handels<br />
<strong>und</strong> der Verbraucher schwebten ihm als Alternative zum Kapitalismus vor. Zentralistische<br />
bürokratische Planung dagegen erschien ihm zu schwerfällig. Sie kann seiner Meinung<br />
nach nicht den Widerspruch zwischen dem „Kollektivistischen der Produktion“ (d.h.<br />
ihrem gesellschaftlichen <strong>und</strong> arbeitsteiligen Charakter) <strong>und</strong> dem „Individualistischen der<br />
Konsumtion“ 29 (dem individuellen Charakter der Bedürfnisse) lösen <strong>und</strong> muß deshalb den<br />
Verbraucher bevorm<strong>und</strong>en. Sie ist auch nicht in der Lage, die Kraft der Kreativität <strong>und</strong> der<br />
freien Initiative des einzelnen <strong>für</strong> den ökonomischen Prozeß auszuschöpfen. Das Ausleben<br />
individueller Fähigkeiten in der Ökonomie setzt aber die freie Verfügung über die<br />
dazu nötigen Geld-<strong>und</strong> Sachmittel voraus. Soweit „Privateigentum“ nur diese Verfügung<br />
vermittelt, ist seine Existenz unbedenklich, schädlich wird sie dagegen immer da, wo sich<br />
das Verfügungsrecht von der Bindung an im gesellschaftlichen Interesse ausgelebte<br />
Tüchtigkeit abkoppelt. Statt Gemeineigentum an den Produktionsmitteln strebt Steiner<br />
einen „Kreislauf dieser Mittel“ an, „der sie immer von neuem zu denjenigen Personen<br />
hinbringt, deren individuelle Fähigkeiten sie in der möglichst besten Art der Gemeinschaft<br />
nutzbar machen können“, ein Vorgang, bei dem die Mitarbeiter des Unternehmens mitzuwirken<br />
haben. 30 Bezeichnet Marx das Gemeineigentum als notwendige Anpassung der<br />
Produktionsverhältnisse an den Charakter der Produktivkräfte, so könnte man mit Steiner<br />
dem entgegenhalten, daß diese Verhältnisse vor allem auch dem erreichten historischen<br />
Stand der menschlichen Individualisierung entsprechen müssen: Das heißt es muß eine<br />
Eigentumsordnung entstehen, die den Anachronismus eines Umgangs mit gesellschaftlichen<br />
Produktionsmitteln nach privater Willkür unterbindet, zugleich aber auch den anderen<br />
Anachronismus einer Entmündigung des selbstverantwortlichen einzelnen vermeidet,<br />
wie sie eintreten muß, wenn der Eigentumsbegriff des römischen Rechts, der von der<br />
vollkommensten <strong>und</strong> ausschließlichen Macht über die Sache ausgeht, nur vom einzelnen<br />
auf Gemeinschaft <strong>und</strong> Staat übertragen wird, statt daß er radikal überw<strong>und</strong>en würde.<br />
Steiners Gesellschaftskonzeption zielt auf eine Annäherung von körperlicher <strong>und</strong> geistiger<br />
Arbeit <strong>und</strong> auf eine Aufhebung des Klassengegensatzes. Sein Konzept einer „Dreigliederung<br />
des <strong>soziale</strong>n Organismus“ meint das Gegenteil einer ständischen Verfassung.<br />
31 Eine Aufhebung der Arbeitsteilung im Sinne der Aufhebung beruflicher Spezialisierung<br />
visiert Steiner allerdings nicht an: Gerade das Prinzip „Jedem nach seinen Fähigkeiten“<br />
erheischt die Spezialisierung. Keine <strong>soziale</strong> Neuordnung kann Fähigkeiten hervorbringen,<br />
sie kann nur vorhandenen Veranlagungen bessere Entwicklungschancen bieten.<br />
Solche Chancengerechtigkeit soll nicht nur durch Demokratisierung des Zugangs zu den<br />
Bildungseinrichtungen, sondern vor allem durch die Ausrichtung des Bildungswesens an<br />
den Erfordernissen einer allseitigen Persönlichkeitsentwicklung hergestellt werden. Die<br />
„Befreiung des Geisteslebens“, „volle Selbstverwaltung“ ist da<strong>für</strong> erforderlich: „Das Erziehungs-<br />
<strong>und</strong> Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst, muß<br />
in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen <strong>und</strong> unterrichten.“ 32 Nur die Frage,<br />
was <strong>für</strong> Anlagen ein Kind mitbringt <strong>und</strong> wie sie entwickelt werden können, soll <strong>für</strong> den<br />
Unterricht maßgebend sein. Damit ist langfristig auch Ökonomie <strong>und</strong> Staat besser gedient<br />
als mit jenem Qualifikationstyp, <strong>für</strong> den sich in der Studentenbewegung der Terminus<br />
„Fachidiotentum“ eingebürgert hat. Ein „Drei-Klassen-Schulsystem“ <strong>und</strong> „Dreigliederung“,<br />
wie sie Steiner wollte, sind unvereinbare Gegensätze. Gerade wer im späteren<br />
Beruf nur einfache, vorwiegend manuelle Arbeit leistet, soll 12 volle Schuljahre lernen<br />
können. In der während der „Dreigliederungszeit“ gegründeten Waldorfschule schuf Steiner<br />
das Modell einer „Freien Schule“. Koedukation, Ablehnung der sogenannten Begabtenauslese<br />
<strong>und</strong> der Verzicht auf das Disziplinierungsmittel der Zensuren <strong>und</strong> des Sitzenbleibens<br />
sind einige seiner Merkmale.<br />
Basis <strong>und</strong> Überbau, als Bild genommen, drücken den von Marx behaupteten Determinationszusammenhang<br />
zwischen der Ökonomie <strong>und</strong> den übrigen gesellschaftlichen Bereichen<br />
gerade nicht aus: In einem von Menschenhand gestalteten Bauwerk tragen die<br />
F<strong>und</strong>amente <strong>und</strong> unteren Geschosse zwar die oberen (Überbau), aber sie determinieren<br />
28<br />
Huber 1979, S. 153.<br />
29<br />
GA 79, Vortr. vom 30. 11. 1921.<br />
30<br />
GA 23, S. 99. Vgl. S. 86ff.<br />
31<br />
Vgl. etwa GA 23, S. 111.<br />
32<br />
ibd. S. 9.<br />
128