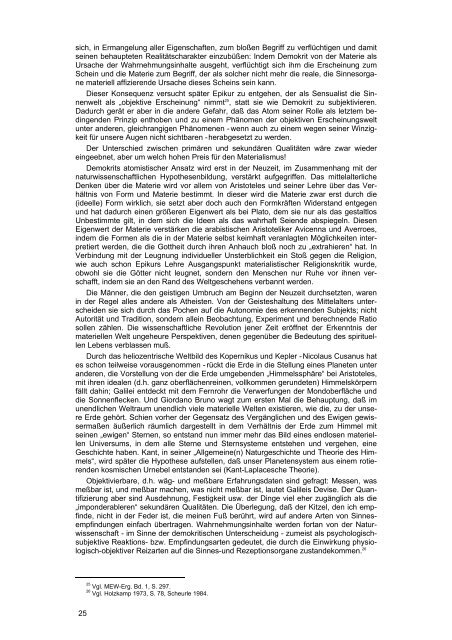Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sich, in Ermangelung aller Eigenschaften, zum bloßen Begriff zu verflüchtigen <strong>und</strong> damit<br />
seinen behaupteten Realitätscharakter einzubüßen: Indem Demokrit von der Materie als<br />
Ursache der Wahrnehmungsinhalte ausgeht, verflüchtigt sich ihm die Erscheinung zum<br />
Schein <strong>und</strong> die Materie zum Begriff, der als solcher nicht mehr die reale, die Sinnesorgane<br />
materiell affizierende Ursache dieses Scheins sein kann.<br />
Dieser Konsequenz versucht später Epikur zu entgehen, der als Sensualist die Sinnenwelt<br />
als „objektive Erscheinung“ nimmt 25 , statt sie wie Demokrit zu subjektivieren.<br />
Dadurch gerät er aber in die andere Gefahr, daß das Atom seiner Rolle als letztem bedingenden<br />
Prinzip enthoben <strong>und</strong> zu einem Phänomen der objektiven Erscheinungswelt<br />
unter anderen, gleichrangigen Phänomenen - wenn auch zu einem wegen seiner Winzigkeit<br />
<strong>für</strong> unsere Augen nicht sichtbaren - herabgesetzt zu werden.<br />
Der Unterschied zwischen primären <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>ären Qualitäten wäre zwar wieder<br />
eingeebnet, aber um welch hohen Preis <strong>für</strong> den Materialismus!<br />
Demokrits atomistischer Ansatz wird erst in der Neuzeit, im Zusammenhang mit der<br />
naturwissenschaftlichen Hypothesenbildung, verstärkt aufgegriffen. Das mittelalterliche<br />
Denken über die Materie wird vor allem von Aristoteles <strong>und</strong> seiner Lehre über das Verhältnis<br />
von Form <strong>und</strong> Materie bestimmt. In dieser wird die Materie zwar erst durch die<br />
(ideelle) Form wirklich, sie setzt aber doch auch den Formkräften Widerstand entgegen<br />
<strong>und</strong> hat dadurch einen größeren Eigenwert als bei Plato, dem sie nur als das gestaltlos<br />
Unbestimmte gilt, in dem sich die Ideen als das wahrhaft Seiende abspiegeln. Diesen<br />
Eigenwert der Materie verstärken die arabistischen Aristoteliker Avicenna <strong>und</strong> Averroes,<br />
indem die Formen als die in der Materie selbst keimhaft veranlagten Möglichkeiten interpretiert<br />
werden, die die Gottheit durch ihren Anhauch bloß noch zu „extrahieren“ hat. In<br />
Verbindung mit der Leugnung individueller Unsterblichkeit ein Stoß gegen die Religion,<br />
wie auch schon Epikurs Lehre Ausgangspunkt materialistischer Religionskritik wurde,<br />
obwohl sie die Götter nicht leugnet, sondern den Menschen nur Ruhe vor ihnen verschafft,<br />
indem sie an den Rand des Weltgeschehens verbannt werden.<br />
Die Männer, die den geistigen Umbruch am Beginn der Neuzeit durchsetzten, waren<br />
in der Regel alles andere als Atheisten. Von der Geisteshaltung des Mittelalters unterscheiden<br />
sie sich durch das Pochen auf die Autonomie des erkennenden Subjekts; nicht<br />
Autorität <strong>und</strong> Tradition, sondern allein Beobachtung, Experiment <strong>und</strong> berechnende Ratio<br />
sollen zählen. Die wissenschaftliche Revolution jener Zeit eröffnet der Erkenntnis der<br />
materiellen Welt ungeheure Perspektiven, denen gegenüber die Bedeutung des spirituellen<br />
Lebens verblassen muß.<br />
Durch das heliozentrische Weltbild des Kopernikus <strong>und</strong> Kepler - Nicolaus Cusanus hat<br />
es schon teilweise vorausgenommen - rückt die Erde in die Stellung eines Planeten unter<br />
anderen, die Vorstellung von der die Erde umgebenden „Himmelssphäre“ bei Aristoteles,<br />
mit ihren idealen (d.h. ganz oberflächenreinen, vollkommen ger<strong>und</strong>eten) Himmelskörpern<br />
fällt dahin; Galilei entdeckt mit dem Fernrohr die Verwerfungen der Mondoberfläche <strong>und</strong><br />
die Sonnenflecken. Und Giordano Bruno wagt zum ersten Mal die Behauptung, daß im<br />
unendlichen Weltraum unendlich viele materielle Welten existieren, wie die, zu der unsere<br />
Erde gehört. Schien vorher der Gegensatz des Vergänglichen <strong>und</strong> des Ewigen gewissermaßen<br />
äußerlich räumlich dargestellt in dem Verhältnis der Erde zum Himmel mit<br />
seinen „ewigen“ Sternen, so entstand nun immer mehr das Bild eines endlosen materiellen<br />
Universums, in dem alle Sterne <strong>und</strong> Sternsysteme entstehen <strong>und</strong> vergehen, eine<br />
Geschichte haben. Kant, in seiner „Allgemeine(n) Naturgeschichte <strong>und</strong> Theorie des Himmels“,<br />
wird später die Hypothese aufstellen, daß unser Planetensystem aus einem rotierenden<br />
kosmischen Urnebel entstanden sei (Kant-Laplacesche Theorie).<br />
Objektivierbare, d.h. wäg- <strong>und</strong> meßbare Erfahrungsdaten sind gefragt: Messen, was<br />
meßbar ist, <strong>und</strong> meßbar machen, was nicht meßbar ist, lautet Galileis Devise. Der Quantifizierung<br />
aber sind Ausdehnung, Festigkeit usw. der Dinge viel eher zugänglich als die<br />
„imponderableren“ sek<strong>und</strong>ären Qualitäten. Die Überlegung, daß der Kitzel, den ich empfinde,<br />
nicht in der Feder ist, die meinen Fuß berührt, wird auf andere Arten von Sinnesempfindungen<br />
einfach übertragen. Wahrnehmungsinhalte werden fortan von der Naturwissenschaft<br />
- im Sinne der demokritischen Unterscheidung - zumeist als psychologischsubjektive<br />
Reaktions- bzw. Empfindungsarten gedeutet, die durch die Einwirkung physiologisch-objektiver<br />
Reizarten auf die Sinnes-<strong>und</strong> Rezeptionsorgane zustandekommen. 26<br />
25<br />
25 Vgl. MEW-Erg. Bd. 1, S. 297.<br />
26 Vgl. Holzkamp 1973, S. 78, Scheurle 1984.