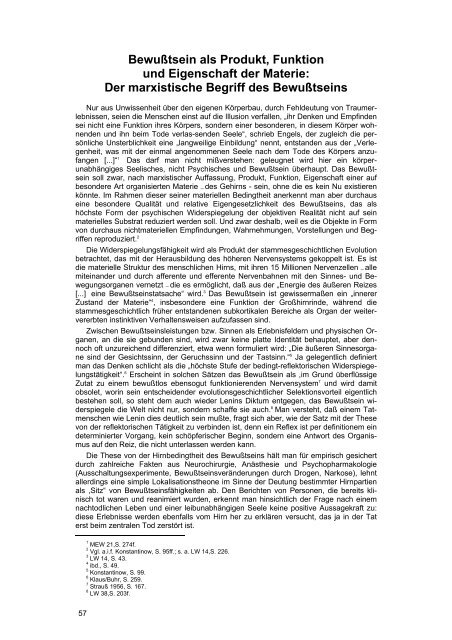Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
57<br />
Bewußtsein als Produkt, Funktion<br />
<strong>und</strong> Eigenschaft der Materie:<br />
Der marxistische Begriff des Bewußtseins<br />
Nur aus Unwissenheit über den eigenen Körperbau, durch Fehldeutung von Traumerlebnissen,<br />
seien die Menschen einst auf die Illusion verfallen, „ihr Denken <strong>und</strong> Empfinden<br />
sei nicht eine Funktion ihres Körpers, sondern einer besonderen, in diesem Körper wohnenden<br />
<strong>und</strong> ihn beim Tode verlas-senden Seele“, schrieb Engels, der zugleich die persönliche<br />
Unsterblichkeit eine „langweilige Einbildung“ nennt, entstanden aus der „Verlegenheit,<br />
was mit der einmal angenommenen Seele nach dem Tode des Körpers anzufangen<br />
[...]“ 1 Das darf man nicht mißverstehen: geleugnet wird hier ein körperunabhängiges<br />
Seelisches, nicht Psychisches <strong>und</strong> Bewußtsein überhaupt. Das Bewußtsein<br />
soll zwar, nach marxistischer Auffassung, Produkt, Funktion, Eigenschaft einer auf<br />
besondere Art organisierten Materie — des Gehirns - sein, ohne die es kein Nu existieren<br />
könnte. Im Rahmen dieser seiner materiellen Bedingtheit anerkennt man aber durchaus<br />
eine besondere Qualität <strong>und</strong> relative Eigengesetzlichkeit des Bewußtseins, das als<br />
höchste Form der psychischen Widerspiegelung der objektiven Realität nicht auf sein<br />
materielles Substrat reduziert werden soll. Und zwar deshalb, weil es die Objekte in Form<br />
von durchaus nichtmateriellen Empfindungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen <strong>und</strong> Begriffen<br />
reproduziert. 2<br />
Die Widerspiegelungsfähigkeit wird als Produkt der stammesgeschichtlichen Evolution<br />
betrachtet, das mit der Herausbildung des höheren Nervensystems gekoppelt ist. Es ist<br />
die materielle Struktur des menschlichen Hirns, mit ihren 15 Millionen Nervenzellen — alle<br />
miteinander <strong>und</strong> durch afferente <strong>und</strong> efferente Nervenbahnen mit den Sinnes- <strong>und</strong> Bewegungsorganen<br />
vernetzt — die es ermöglicht, daß aus der „Energie des äußeren Reizes<br />
[...] eine Bewußtseinstatsache“ wird. 3 Das Bewußtsein ist gewissermaßen ein „innerer<br />
Zustand der Materie“ 4 , insbesondere eine Funktion der Großhirnrinde, während die<br />
stammesgeschichtlich früher entstandenen subkortikalen Bereiche als Organ der weitervererbten<br />
instinktiven Verhaltensweisen aufzufassen sind.<br />
Zwischen Bewußtseinsleistungen bzw. Sinnen als Erlebnisfeldern <strong>und</strong> physischen Organen,<br />
an die sie geb<strong>und</strong>en sind, wird zwar keine platte Identität behauptet, aber dennoch<br />
oft unzureichend differenziert, etwa wenn formuliert wird: „Die äußeren Sinnesorgane<br />
sind der Gesichtssinn, der Geruchssinn <strong>und</strong> der Tastsinn.“ 5 Ja gelegentlich definiert<br />
man das Denken schlicht als die „höchste Stufe der bedingt-reflektorischen Widerspiegelungstätigkeit“.<br />
6 Erscheint in solchen Sätzen das Bewußtsein als ,im Gr<strong>und</strong> überflüssige<br />
Zutat zu einem bewußtlos ebensogut funktionierenden Nervensystem 7 <strong>und</strong> wird damit<br />
obsolet, worin sein entscheidender evolutionsgeschichtlicher Selektionsvorteil eigentlich<br />
bestehen soll, so steht dem auch wieder Lenins Diktum entgegen, das Bewußtsein widerspiegele<br />
die Welt nicht nur, sondern schaffe sie auch. 8 Man versteht, daß einem Tatmenschen<br />
wie Lenin dies deutlich sein mußte, fragt sich aber, wie der Satz mit der These<br />
von der reflektorischen Tätigkeit zu verbinden ist, denn ein Reflex ist per definitionem ein<br />
determinierter Vorgang, kein schöpferischer Beginn, sondern eine Antwort des Organismus<br />
auf den Reiz, die nicht unterlassen werden kann.<br />
Die These von der Hirnbedingtheit des Bewußtseins hält man <strong>für</strong> empirisch gesichert<br />
durch zahlreiche Fakten aus Neurochirurgie, Anästhesie <strong>und</strong> Psychopharmakologie<br />
(Ausschaltungsexperimente, Bewußtseinsveränderungen durch Drogen, Narkose), lehnt<br />
allerdings eine simple Lokalisationstheone im Sinne der Deutung bestimmter Hirnpartien<br />
als ,Sitz“ von Bewußtseinsfähigkeiten ab. Den Berichten von Personen, die bereits klinisch<br />
tot waren <strong>und</strong> reanimiert wurden, erkennt man hinsichtlich der Frage nach einem<br />
nachtodlichen Leben <strong>und</strong> einer leibunabhängigen Seele keine positive Aussagekraft zu:<br />
diese Erlebnisse werden ebenfalls vom Hirn her zu erklären versucht, das ja in der Tat<br />
erst beim zentralen Tod zerstört ist.<br />
1<br />
MEW 21,S. 274f.<br />
2<br />
Vgl. a.i.f. Konstantinow, S. 95ff.; s. a. LW 14,S. 226.<br />
3<br />
LW 14, S. 43.<br />
4<br />
ibd., S. 49.<br />
5<br />
Konstantinow, S. 99.<br />
6<br />
Klaus/Buhr, S. 259.<br />
7<br />
Strauß 1956, S. 167.<br />
8<br />
LW 38,S. 203f.