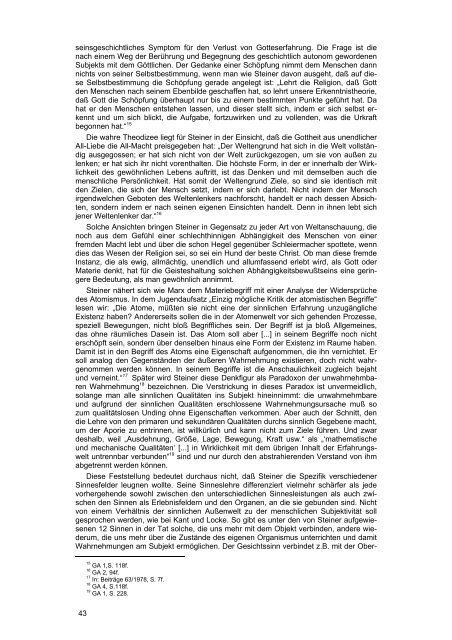Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
seinsgeschichtliches Symptom <strong>für</strong> den Verlust von Gotteserfahrung. Die Frage ist die<br />
nach einem Weg der Berührung <strong>und</strong> Begegnung des geschichtlich autonom gewordenen<br />
Subjekts mit dem Göttlichen. Der Gedanke einer Schöpfung nimmt dem Menschen dann<br />
nichts von seiner Selbstbestimmung, wenn man wie Steiner davon ausgeht, daß auf diese<br />
Selbstbestimmung die Schöpfung gerade angelegt ist: „Lehrt die Religion, daß Gott<br />
den Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen hat, so lehrt unsere Erkenntnistheorie,<br />
daß Gott die Schöpfung überhaupt nur bis zu einem bestimmten Punkte geführt hat. Da<br />
hat er den Menschen entstehen lassen, <strong>und</strong> dieser stellt sich, indem er sich selbst erkennt<br />
<strong>und</strong> um sich blickt, die Aufgabe, fortzuwirken <strong>und</strong> zu vollenden, was die Urkraft<br />
begonnen hat.“ 15<br />
Die wahre Theodizee liegt <strong>für</strong> Steiner in der Einsicht, daß die Gottheit aus unendlicher<br />
All-Liebe die All-Macht preisgegeben hat: „Der Weltengr<strong>und</strong> hat sich in die Welt vollständig<br />
ausgegossen; er hat sich nicht von der Welt zurückgezogen, um sie von außen zu<br />
lenken; er hat sich ihr nicht vorenthalten. Die höchste Form, in der er innerhalb der Wirklichkeit<br />
des gewöhnlichen Lebens auftritt, ist das Denken <strong>und</strong> mit demselben auch die<br />
menschliche Persönlichkeit. Hat somit der Weltengr<strong>und</strong> Ziele, so sind sie identisch mit<br />
den Zielen, die sich der Mensch setzt, indem er sich darlebt. Nicht indem der Mensch<br />
irgendwelchen Geboten des Weltenlenkers nachforscht, handelt er nach dessen Absichten,<br />
sondern indem er nach seinen eigenen Einsichten handelt. Denn in ihnen lebt sich<br />
jener Weltenlenker dar.“ 16<br />
Solche Ansichten bringen Steiner in Gegensatz zu jeder Art von Weltanschauung, die<br />
noch aus dem Gefühl einer schlechthinnigen Abhängigkeit des Menschen von einer<br />
fremden Macht lebt <strong>und</strong> über die schon Hegel gegenüber Schleiermacher spottete, wenn<br />
dies das Wesen der Religion sei, so sei ein H<strong>und</strong> der beste Christ. Ob man diese fremde<br />
Instanz, die als ewig, allmächtig, unendlich <strong>und</strong> allumfassend erlebt wird, als Gott oder<br />
Materie denkt, hat <strong>für</strong> die Geisteshaltung solchen Abhängigkeitsbewußtseins eine geringere<br />
Bedeutung, als man gewöhnlich annimmt.<br />
Steiner nähert sich wie Marx dem Materiebegriff mit einer Analyse der Widersprüche<br />
des Atomismus. In dem Jugendaufsatz „Einzig mögliche Kritik der atomistischen Begriffe“<br />
lesen wir: „Die Atome, müßten sie nicht eine der sinnlichen Erfahrung unzugängliche<br />
Existenz haben? Andererseits sollen die in der Atomenwelt vor sich gehenden Prozesse,<br />
speziell Bewegungen, nicht bloß Begriffliches sein. Der Begriff ist ja bloß Allgemeines,<br />
das ohne räumliches Dasein ist. Das Atom soll aber [...] in seinem Begriffe noch nicht<br />
erschöpft sein, sondern über denselben hinaus eine Form der Existenz im Raume haben.<br />
Damit ist in den Begriff des Atoms eine Eigenschaft aufgenommen, die ihn vernichtet. Er<br />
soll analog den Gegenständen der äußeren Wahrnehmung existieren, doch nicht wahrgenommen<br />
werden können. In seinem Begriffe ist die Anschaulichkeit zugleich bejaht<br />
<strong>und</strong> verneint.“ 17 Später wird Steiner diese Denkfigur als Paradoxon der unwahrnehmbaren<br />
Wahrnehmung 18 bezeichnen. Die Verstrickung in dieses Paradox ist unvermeidlich,<br />
solange man alle sinnlichen Qualitäten ins Subjekt hineinnimmt: die unwahrnehmbare<br />
<strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der sinnlichen Qualitäten erschlossene Wahrnehmungsursache muß so<br />
zum qualitätslosen Unding ohne Eigenschaften verkommen. Aber auch der Schnitt, den<br />
die Lehre von den primaren <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>ären Qualitäten durchs sinnlich Gegebene macht,<br />
um der Aporie zu entrinnen, ist willkürlich <strong>und</strong> kann nicht zum Ziele führen. Und zwar<br />
deshalb, weil „Ausdehnung, Größe, Lage, Bewegung, Kraft usw.“ als „‘mathematische<br />
<strong>und</strong> mechanische Qualitäten‘ [...] in Wirklichkeit mit dem übrigen Inhalt der Erfahrungswelt<br />
untrennbar verb<strong>und</strong>en“ 19 sind <strong>und</strong> nur durch den abstrahierenden Verstand von ihm<br />
abgetrennt werden können.<br />
Diese Feststellung bedeutet durchaus nicht, daß Steiner die Spezifik verschiedener<br />
Sinnesfelder leugnen wollte. Seine Sinneslehre differenziert vielmehr schärfer als jede<br />
vorhergehende sowohl zwischen den unterschiedlichen Sinnesleistungen als auch zwischen<br />
den Sinnen als Erlebnisfeldern <strong>und</strong> den Organen, an die sie geb<strong>und</strong>en sind. Nicht<br />
von einem Verhältnis der sinnlichen Außenwelt zu der menschlichen Subjektivität soll<br />
gesprochen werden, wie bei Kant <strong>und</strong> Locke. So gibt es unter den von Steiner aufgewiesenen<br />
12 Sinnen in der Tat solche, die uns mehr mit dem Objekt verbinden, andere wiederum,<br />
die uns mehr über die Zustände des eigenen Organismus unterrichten <strong>und</strong> damit<br />
Wahrnehmungen am Subjekt ermöglichen. Der Gesichtssinn verbindet z.B. mit der Ober-<br />
43<br />
15 GA 1,S. 118f.<br />
16 GA 2, 94f.<br />
17 In: Beiträge 63/1978, S. 7f.<br />
18 GA 4, S.118f.<br />
19 GA 1, S. 228.