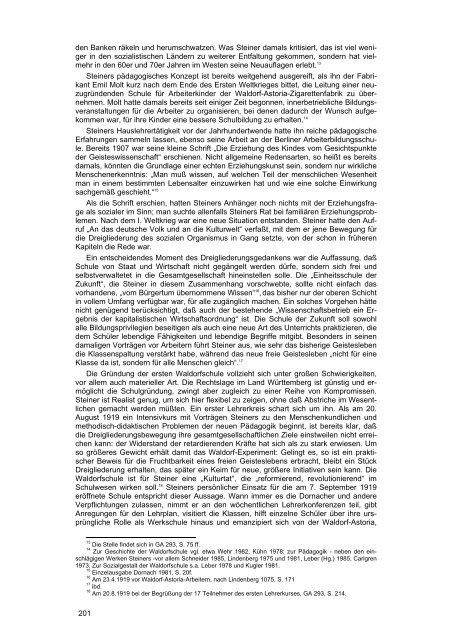Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
den Banken räkeln <strong>und</strong> herumschwatzen. Was Steiner damals kritisiert, das ist viel weniger<br />
in den sozialistischen Ländern zu weiterer Entfaltung gekommen, sondern hat vielmehr<br />
in den 60er <strong>und</strong> 70er Jahren im Westen seine Neuauflagen erlebt. 13<br />
Steiners pädagogisches Konzept ist bereits weitgehend ausgereift, als ihn der Fabrikant<br />
Emil Molt kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges bittet, die Leitung einer neuzugründenden<br />
Schule <strong>für</strong> Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik zu übernehmen.<br />
Molt hatte damals bereits seit einiger Zeit begonnen, innerbetriebliche Bildungsveranstaltungen<br />
<strong>für</strong> die Arbeiter zu organisieren, bei denen dadurch der Wunsch aufgekommen<br />
war, <strong>für</strong> ihre Kinder eine bessere Schulbildung zu erhalten. 14<br />
Steiners Hauslehrertätigkeit vor der Jahrh<strong>und</strong>ertwende hatte ihn reiche pädagogische<br />
Erfahrungen sammeln lassen, ebenso seine Arbeit an der Berliner Arbeiterbildungsschule.<br />
Bereits 1907 war seine kleine Schrift „Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte<br />
der Geisteswissenschaft“ erschienen. Nicht allgemeine Redensarten, so heißt es bereits<br />
damals, könnten die Gr<strong>und</strong>lage einer echten Erziehungskunst sein, sondern nur wirkliche<br />
Menschenerkenntnis: „Man muß wissen, auf welchen Teil der menschlichen Wesenheit<br />
man in einem bestimmten Lebensalter einzuwirken hat <strong>und</strong> wie eine solche Einwirkung<br />
sachgemäß geschieht.“ 15<br />
Als die Schrift erschien, hatten Steiners Anhänger noch nichts mit der Erziehungsfrage<br />
als <strong>soziale</strong>r im Sinn; man suchte allenfalls Steiners Rat bei familiären Erziehungsproblemen.<br />
Nach dem I. Weltkrieg war eine neue Situation entstanden. Steiner hatte den Aufruf<br />
„An das deutsche Volk <strong>und</strong> an die Kulturwelt“ verfaßt, mit dem er jene Bewegung <strong>für</strong><br />
die Dreigliederung des <strong>soziale</strong>n Organismus in Gang setzte, von der schon in früheren<br />
Kapiteln die Rede war.<br />
Ein entscheidendes Moment des Dreigliederungsgedankens war die Auffassung, daß<br />
Schule von Staat <strong>und</strong> Wirtschaft nicht gegängelt werden dürfe, sondern sich frei <strong>und</strong><br />
selbstverwaltetet in die Gesamtgesellschaft hineinstellen solle. Die „Einheitsschule der<br />
Zukunft“, die Steiner in diesem Zusammenhang vorschwebte, sollte nicht einfach das<br />
vorhandene, „vom Bürgertum übernommene Wissen“ 16 , das bisher nur der oberen Schicht<br />
in vollem Umfang verfügbar war, <strong>für</strong> alle zugänglich machen. Ein solches Vorgehen hätte<br />
nicht genügend berücksichtigt, daß auch der bestehende „Wissenschaftsbetrieb ein Ergebnis<br />
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung“ ist. Die Schule der Zukunft soll sowohl<br />
alle Bildungsprivilegien beseitigen als auch eine neue Art des Unterrichts praktizieren, die<br />
dem Schüler lebendige Fähigkeiten <strong>und</strong> lebendige Begriffe mitgibt. Besonders in seinen<br />
damaligen Vorträgen vor Arbeitern führt Steiner aus, wie sehr das bisherige Geistesleben<br />
die Klassenspaltung verstärkt habe, während das neue freie Geistesleben „nicht <strong>für</strong> eine<br />
Klasse da ist, sondern <strong>für</strong> alle Menschen gleich“. 17<br />
Die Gründung der ersten Waldorfschule vollzieht sich unter großen Schwierigkeiten,<br />
vor allem auch materieller Art. Die Rechtslage im Land Württemberg ist günstig <strong>und</strong> ermöglicht<br />
die Schulgründung, zwingt aber zugleich zu einer Reihe von Kompromissen.<br />
Steiner ist Realist genug, um sich hier flexibel zu zeigen, ohne daß Abstriche im Wesentlichen<br />
gemacht werden müßten. Ein erster Lehrerkreis schart sich um ihn. Als am 20.<br />
August 1919 ein Intensivkurs mit Vorträgen Steiners zu den Menschenk<strong>und</strong>lichen <strong>und</strong><br />
methodisch-didaktischen Problemen der neuen Pädagogik beginnt, ist bereits klar, daß<br />
die Dreigliederungsbewegung ihre gesamtgesellschaftlichen Ziele einstweilen nicht erreichen<br />
kann: der Widerstand der retardierenden Kräfte hat sich als zu stark erwiesen. Um<br />
so größeres Gewicht erhält damit das Waldorf-Experiment: Gelingt es, so ist ein praktischer<br />
Beweis <strong>für</strong> die Fruchtbarkeit eines freien Geisteslebens erbracht, bleibt ein Stück<br />
Dreigliederung erhalten, das später ein Keim <strong>für</strong> neue, größere Initiativen sein kann. Die<br />
Waldorfschule ist <strong>für</strong> Steiner eine „Kulturtat“, die „reformierend, revolutionierend“ im<br />
Schulwesen wirken soll. 18 Steiners persönlicher Einsatz <strong>für</strong> die am 7. September 1919<br />
eröffnete Schule entspricht dieser Aussage. Wann immer es die Dornacher <strong>und</strong> andere<br />
Verpflichtungen zulassen, nimmt er an den wöchentlichen Lehrerkonferenzen teil, gibt<br />
Anregungen <strong>für</strong> den Lehrplan, visitiert die Klassen, hilft einzelne Schüler über ihre ursprüngliche<br />
Rolle als Werkschule hinaus <strong>und</strong> emanzipiert sich von der Waldorf-Astoria,<br />
13<br />
Die Stelle findet sich in GA 293, S. 75 ff.<br />
14<br />
Zur Geschichte der Waldorfschule vgl. etwa Wehr 1982, Kühn 1978; zur Pädagogik - neben den einschlägigen<br />
Werken Steiners -vor allem Schneider 1985, Lindenberg 1975 <strong>und</strong> 1981, Leber (Hg.) 1985, Carlgren<br />
1973. Zur Sozialgestalt der Waldorfschule s.a. Leber 1978 <strong>und</strong> Kugler 1981.<br />
15<br />
Einzelausgabe Dornach 1981, S. 20f.<br />
16<br />
Am 23.4.1919 vor Waldorf-Astoria-Arbeitern, nach Lindenberg 1075, S. 171<br />
17<br />
ibd.<br />
18<br />
Am 20.8.1919 bei der Begrüßung der 17 Teilnehmer des ersten Lehrerkurses, GA 293, S. 214.<br />
201