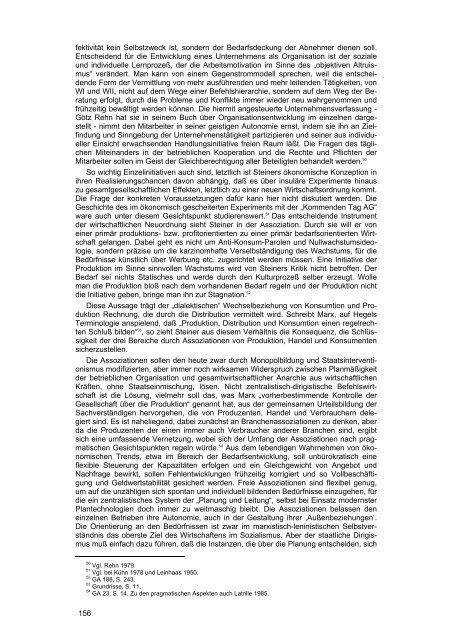Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
fektivität kein Selbstzweck ist, sondern der Bedarfsdeckung der Abnehmer dienen soll.<br />
Entscheidend <strong>für</strong> die Entwicklung eines Unternehmens als Organisation ist der <strong>soziale</strong><br />
<strong>und</strong> individuelle Lernprozeß, der die Arbeitsmotivation im Sinne des „objektiven Altruismus“<br />
verändert. Man kann von einem Gegenstrommodell sprechen, weil die entscheidende<br />
Form der Vermittlung von mehr ausführenden <strong>und</strong> mehr leitenden Tätigkeiten, von<br />
WI <strong>und</strong> WII, nicht auf dem Wege einer Befehlshierarchie, sondern auf dem Weg der Beratung<br />
erfolgt, durch die Probleme <strong>und</strong> Konflikte immer wieder neu wahrgenommen <strong>und</strong><br />
frühzeitig bewältigt werden können. Die hiermit angesteuerte Unternehmensverfassung -<br />
Götz Rehn hat sie in seinem Buch über Organisationsentwicklung im einzelnen dargestellt<br />
- nimmt den Mitarbeiter in seiner geistigen Autonomie ernst, indem sie ihn an Zielfindung<br />
<strong>und</strong> Sinngebung der Unternehmenstätigkeit partizipieren <strong>und</strong> seiner aus individueller<br />
Einsicht erwachsenden Handlungsinitiative freien Raum läßt. Die Fragen des täglichen<br />
Miteinanders in der betrieblichen Kooperation <strong>und</strong> die Rechte <strong>und</strong> Pflichten der<br />
Mitarbeiter sollen im Geist der Gleichberechtigung aller Beteiligten behandelt werden. 50<br />
So wichtig Einzelinitiativen auch sind, letztlich ist Steiners ökonomische Konzeption in<br />
ihren Realisierungschancen davon abhängig, daß es über insuläre Experimente hinaus<br />
zu gesamtgesellschaftlichen Effekten, letztlich zu einer neuen Wirtschaftsordnung kommt.<br />
Die Frage der konkreten Voraussetzungen da<strong>für</strong> kann hier nicht diskutiert werden. Die<br />
Geschichte des im ökonomisch gescheiterten Experiments mit der „Kommenden Tag AG“<br />
ware auch unter diesem Gesichtspunkt studierenswert. 51 Das entscheidende Instrument<br />
der wirtschaftlichen Neuordnung sieht Steiner in der Assoziation. Durch sie will er von<br />
einer primär produktions- bzw. profitorientierten zu einer primär bedarfsorientierten Wirtschaft<br />
gelangen. Dabei geht es nicht um Anti-Konsum-Parolen <strong>und</strong> Nullwachstumsideologie,<br />
sondern präzise um die karzinomhafte Verselbständigung des Wachstums, <strong>für</strong> die<br />
Bedürfnisse künstlich über Werbung etc. zugerichtet werden müssen. Eine Initiative der<br />
Produktion im Sinne sinnvollen Wachstums wird von Steiners Kritik nicht betroffen. Der<br />
Bedarf sei nichts Statisches <strong>und</strong> werde durch den Kulturprozeß selber erzeugt. Wolle<br />
man die Produktion bloß nach dem vorhandenen Bedarf regeln <strong>und</strong> der Produktion nicht<br />
die Initiative geben, bringe man ihn zur Stagnation. 52<br />
Diese Aussage trägt der „dialektischen“ Wechselbeziehung von Konsumtion <strong>und</strong> Produktion<br />
Rechnung, die durch die Distribution vermittelt wird. Schreibt Marx, auf Hegels<br />
Terminologie anspielend, daß „Produktion, Distribution <strong>und</strong> Konsumtion einen regelrechten<br />
Schluß bilden“ 53 , so zieht Steiner aus diesem Verhältnis die Konsequenz, die Schlüssigkeit<br />
der drei Bereiche durch Assoziationen von Produktion, Handel <strong>und</strong> Konsumenten<br />
sicherzustellen.<br />
Die Assoziationen sollen den heute zwar durch Monopolbildung <strong>und</strong> Staatsinterventionismus<br />
modifizierten, aber immer noch wirksamen Widerspruch zwischen Planmäßigkeit<br />
der betrieblichen Organisation <strong>und</strong> gesamtwirtschaftlicher Anarchie aus wirtschaftlichen<br />
Kräften, ohne Staatseinmischung, lösen. Nicht zentralistisch-dirigistische Befehlswirtschaft<br />
ist die Lösung, vielmehr soll das, was Marx „vorherbestimmende Kontrolle der<br />
Gesellschaft über die Produktion“ genannt hat, aus der gemeinsamen Urteilsbildung der<br />
Sachverständigen hervorgehen, die von Produzenten, Handel <strong>und</strong> Verbrauchern delegiert<br />
sind. Es ist naheliegend, dabei zunächst an Branchenassoziationen zu denken, aber<br />
da die Produzenten der einen immer auch Verbraucher anderer Branchen sind, ergibt<br />
sich eine umfassende Vernetzung, wobei sich der Umfang der Assoziationen nach pragmatischen<br />
Gesichtspunkten regeln würde. 54 Aus dem lebendigen Wahrnehmen von ökonomischen<br />
Trends, etwa im Bereich der Bedarfsentwicklung, soll unbürokratisch eine<br />
flexible Steuerung der Kapazitäten erfolgen <strong>und</strong> ein Gleichgewicht von Angebot <strong>und</strong><br />
Nachfrage bewirkt, sollen Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert <strong>und</strong> so Vollbeschäftigung<br />
<strong>und</strong> Geldwertstabilität gesichert werden. Freie Assoziationen sind flexibel genug,<br />
um auf die unzähligen sich spontan <strong>und</strong> individuell bildenden Bedürfnisse einzugehen, <strong>für</strong><br />
die ein zentralistisches System der „Planung <strong>und</strong> Leitung“, selbst bei Einsatz modernster<br />
Plantechnologien doch immer zu weitmaschig bleibt. Die Assoziationen belassen den<br />
einzelnen Betrieben ihre Autonomie, auch in der Gestaltung ihrer ,Außenbeziehungen‘.<br />
Die Orientierung an den Bedürfnissen ist zwar im marxistisch-leninistischen Selbstverständnis<br />
das oberste Ziel des Wirtschaftens im Sozialismus. Aber der staatliche Dirigismus<br />
muß einfach dazu führen, daß die Instanzen, die über die Planung entscheiden, sich<br />
50<br />
Vgl. Rehn 1979.<br />
51<br />
Vgl. bei Kühn 1978 <strong>und</strong> Leinhaas 1950.<br />
52<br />
GA 188, S. 243.<br />
53<br />
Gr<strong>und</strong>risse, S. 11.<br />
54<br />
GA 23, S. 14. Zu den pragmatischen Aspekten auch Latrille 1985.<br />
156