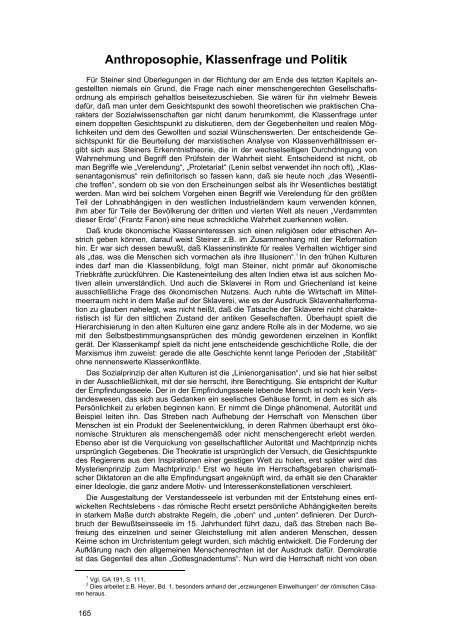Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
165<br />
<strong>Anthroposophie</strong>, Klassenfrage <strong>und</strong> Politik<br />
Für Steiner sind Überlegungen in der Richtung der am Ende des letzten Kapitels angestellten<br />
niemals ein Gr<strong>und</strong>, die Frage nach einer menschengerechten Gesellschaftsordnung<br />
als empirisch gehaltlos beiseitezuschieben. Sie wären <strong>für</strong> ihn vielmehr Beweis<br />
da<strong>für</strong>, daß man unter dem Gesichtspunkt des sowohl theoretischen wie praktischen Charakters<br />
der Sozialwissenschaften gar nicht darum herumkommt, die Klassenfrage unter<br />
einem doppelten Gesichtspunkt zu diskutieren, dem der Gegebenheiten <strong>und</strong> realen Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> dem des Gewollten <strong>und</strong> sozial Wünschenswerten. Der entscheidende Gesichtspunkt<br />
<strong>für</strong> die Beurteilung der marxistischen Analyse von Klassenverhältnissen ergibt<br />
sich aus Steiners Erkenntnistheorie, die in der wechselseitigen Durchdringung von<br />
Wahrnehmung <strong>und</strong> Begriff den Prüfstein der Wahrheit sieht. Entscheidend ist nicht, ob<br />
man Begriffe wie „Verelendung“, „Proletariat“ (Lenin selbst verwendet ihn noch oft), „Klassenantagonismus“<br />
rein definitorisch so fassen kann, daß sie heute noch „das Wesentliche<br />
treffen“, sondern ob sie von den Erscheinungen selbst als ihr Wesentliches bestätigt<br />
werden. Man wird bei solchem Vorgehen einen Begriff wie Verelendung <strong>für</strong> den größten<br />
Teil der Lohnabhängigen in den westlichen Industrieländern kaum verwenden können,<br />
ihm aber <strong>für</strong> Teile der Bevölkerung der dritten <strong>und</strong> vierten Welt als neuen „Verdammten<br />
dieser Erde“ (Frantz Fanon) eine neue schreckliche Wahrheit zuerkennen wollen.<br />
Daß krude ökonomische Klasseninteressen sich einen religiösen oder ethischen Anstrich<br />
geben können, darauf weist Steiner z.B. im Zusammenhang mit der Reformation<br />
hin. Er war sich dessen bewußt, daß Klasseninstinkte <strong>für</strong> reales Verhalten wichtiger sind<br />
als „das, was die Menschen sich vormachen als ihre Illusionen“. 1 In den frühen Kulturen<br />
indes darf man die Klassenbildung, folgt man Steiner, nicht primär auf ökonomische<br />
Triebkräfte zurückführen. Die Kasteneinteilung des alten Indien etwa ist aus solchen Motiven<br />
allein unverständlich. Und auch die Sklaverei in Rom <strong>und</strong> Griechenland ist keine<br />
ausschließliche Frage des ökonomischen Nutzens. Auch ruhte die Wirtschaft im Mittelmeerraum<br />
nicht in dem Maße auf der Sklaverei, wie es der Ausdruck Sklavenhalterformation<br />
zu glauben nahelegt, was nicht heißt, daß die Tatsache der Sklaverei nicht charakteristisch<br />
ist <strong>für</strong> den sittlichen Zustand der antiken Gesellschaften. Überhaupt spielt die<br />
Hierarchisierung in den alten Kulturen eine ganz andere Rolle als in der Moderne, wo sie<br />
mit den Selbstbestimmungsansprüchen des mündig gewordenen einzelnen in Konflikt<br />
gerät. Der Klassenkampf spielt da nicht jene entscheidende geschichtliche Rolle, die der<br />
<strong>Marxismus</strong> ihm zuweist: gerade die alte Geschichte kennt lange Perioden der „Stabilität“<br />
ohne nennenswerte Klassenkonflikte.<br />
Das Sozialprinzip der alten Kulturen ist die „Linienorganisation“, <strong>und</strong> sie hat hier selbst<br />
in der Ausschließlichkeit, mit der sie herrscht, ihre Berechtigung. Sie entspricht der Kultur<br />
der Empfindungsseele. Der in der Empfindungsseele lebende Mensch ist noch kein Verstandeswesen,<br />
das sich aus Gedanken ein seelisches Gehäuse formt, in dem es sich als<br />
Persönlichkeit zu erleben beginnen kann. Er nimmt die Dinge phänomenal, Autorität <strong>und</strong><br />
Beispiel leiten ihn. Das Streben nach Aufhebung der Herrschaft von Menschen über<br />
Menschen ist ein Produkt der Seelenentwicklung, in deren Rahmen überhaupt erst ökonomische<br />
Strukturen als menschengemäß oder nicht menschengerecht erlebt werden.<br />
Ebenso aber ist die Verquickung von gesellschaftlicher Autorität <strong>und</strong> Machtprinzip nichts<br />
ursprünglich Gegebenes. Die Theokratie ist ursprünglich der Versuch, die Gesichtspunkte<br />
des Regierens aus den Inspirationen einer geistigen Welt zu holen, erst später wird das<br />
Mysterienprinzip zum Machtprinzip. 2 Erst wo heute im Herrschaftsgebaren charismatischer<br />
Diktatoren an die alte Empfindungsart angeknüpft wird, da erhält sie den Charakter<br />
einer Ideologie, die ganz andere Motiv- <strong>und</strong> Interessenkonstellationen verschleiert.<br />
Die Ausgestaltung der Verstandesseele ist verb<strong>und</strong>en mit der Entstehung eines entwickelten<br />
Rechtslebens - das römische Recht ersetzt persönliche Abhängigkeiten bereits<br />
in starkem Maße durch abstrakte Regeln, die „oben“ <strong>und</strong> „unten“ definieren. Der Durchbruch<br />
der Bewußtseinsseele im 15. Jahrh<strong>und</strong>ert führt dazu, daß das Streben nach Befreiung<br />
des einzelnen <strong>und</strong> seiner Gleichstellung mit allen anderen Menschen, dessen<br />
Keime schon im Urchristentum gelegt wurden, sich mächtig entwickelt. Die Forderung der<br />
Aufklärung nach den allgemeinen Menschenrechten ist der Ausdruck da<strong>für</strong>. Demokratie<br />
ist das Gegenteil des alten „Gottesgnadentums“. Nun wird die Herrschaft nicht von oben<br />
1<br />
Vgl. GA 191, S. 111.<br />
2<br />
Dies arbeitet z.B. Heyer, Bd. 1, besonders anhand der „erzwungenen Einweihungen“ der römischen Cäsaren<br />
heraus.