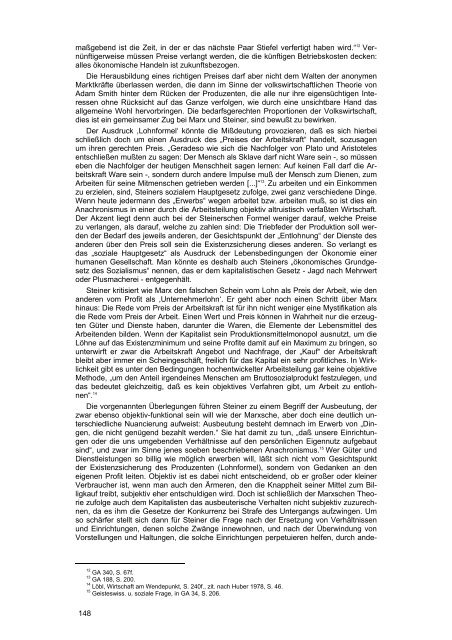Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
maßgebend ist die Zeit, in der er das nächste Paar Stiefel verfertigt haben wird.“ 12 Vernünftigerweise<br />
müssen Preise verlangt werden, die die künftigen Betriebskosten decken:<br />
alles ökonomische Handeln ist zukunftsbezogen.<br />
Die Herausbildung eines richtigen Preises darf aber nicht dem Walten der anonymen<br />
Marktkräfte überlassen werden, die dann im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie von<br />
Adam Smith hinter dem Rücken der Produzenten, die alle nur ihre eigensüchtigen Interessen<br />
ohne Rücksicht auf das Ganze verfolgen, wie durch eine unsichtbare Hand das<br />
allgemeine Wohl hervorbringen. Die bedarfsgerechten Proportionen der Volkswirtschaft,<br />
dies ist ein gemeinsamer Zug bei Marx <strong>und</strong> Steiner, sind bewußt zu bewirken.<br />
Der Ausdruck ,Lohnformel‘ könnte die Mißdeutung provozieren, daß es sich hierbei<br />
schließlich doch um einen Ausdruck des „Preises der Arbeitskraft“ handelt, sozusagen<br />
um ihren gerechten Preis. „Geradeso wie sich die Nachfolger von Plato <strong>und</strong> Aristoteles<br />
entschließen mußten zu sagen: Der Mensch als Sklave darf nicht Ware sein -, so müssen<br />
eben die Nachfolger der heutigen Menschheit sagen lernen: Auf keinen Fall darf die Arbeitskraft<br />
Ware sein -, sondern durch andere Impulse muß der Mensch zum Dienen, zum<br />
Arbeiten <strong>für</strong> seine Mitmenschen getrieben werden [...]“ 13 . Zu arbeiten <strong>und</strong> ein Einkommen<br />
zu erzielen, sind, Steiners <strong>soziale</strong>m Hauptgesetz zufolge, zwei ganz verschiedene Dinge.<br />
Wenn heute jedermann des „Erwerbs“ wegen arbeitet bzw. arbeiten muß, so ist dies ein<br />
Anachronismus in einer durch die Arbeitsteilung objektiv altruistisch verfaßten Wirtschaft.<br />
Der Akzent liegt denn auch bei der Steinerschen Formel weniger darauf, welche Preise<br />
zu verlangen, als darauf, welche zu zahlen sind: Die Triebfeder der Produktion soll werden<br />
der Bedarf des jeweils anderen, der Gesichtspunkt der „Entlohnung“ der Dienste des<br />
anderen über den Preis soll sein die Existenzsicherung dieses anderen. So verlangt es<br />
das „<strong>soziale</strong> Hauptgesetz“ als Ausdruck der Lebensbedingungen der Ökonomie einer<br />
humanen Gesellschaft. Man könnte es deshalb auch Steiners „ökonomisches Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
des Sozialismus“ nennen, das er dem kapitalistischen Gesetz - Jagd nach Mehrwert<br />
oder Plusmacherei - entgegenhält.<br />
Steiner kritisiert wie Marx den falschen Schein vom Lohn als Preis der Arbeit, wie den<br />
anderen vom Profit als ,Unternehmerlohn‘. Er geht aber noch einen Schritt über Marx<br />
hinaus: Die Rede vom Preis der Arbeitskraft ist <strong>für</strong> ihn nicht weniger eine Mystifikation als<br />
die Rede vom Preis der Arbeit. Einen Wert <strong>und</strong> Preis können in Wahrheit nur die erzeugten<br />
Güter <strong>und</strong> Dienste haben, darunter die Waren, die Elemente der Lebensmittel des<br />
Arbeitenden bilden. Wenn der Kapitalist sein Produktionsmittelmonopol ausnutzt, um die<br />
Löhne auf das Existenzminimum <strong>und</strong> seine Profite damit auf ein Maximum zu bringen, so<br />
unterwirft er zwar die Arbeitskraft Angebot <strong>und</strong> Nachfrage, der „Kauf“ der Arbeitskraft<br />
bleibt aber immer ein Scheingeschäft, freilich <strong>für</strong> das Kapital ein sehr profitliches. In Wirklichkeit<br />
gibt es unter den Bedingungen hochentwickelter Arbeitsteilung gar keine objektive<br />
Methode, „um den Anteil irgendeines Menschen am Bruttosozialprodukt festzulegen, <strong>und</strong><br />
das bedeutet gleichzeitig, daß es kein objektives Verfahren gibt, um Arbeit zu entlohnen“.<br />
14<br />
Die vorgenannten Überlegungen führen Steiner zu einem Begriff der Ausbeutung, der<br />
zwar ebenso objektiv-funktional sein will wie der Marxsche, aber doch eine deutlich unterschiedliche<br />
Nuancierung aufweist: Ausbeutung besteht demnach im Erwerb von „Dingen,<br />
die nicht genügend bezahlt werden.“ Sie hat damit zu tun, „daß unsere Einrichtungen<br />
oder die uns umgebenden Verhältnisse auf den persönlichen Eigennutz aufgebaut<br />
sind“, <strong>und</strong> zwar im Sinne jenes soeben beschriebenen Anachronismus. 15 Wer Güter <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen so billig wie möglich erwerben will, läßt sich nicht vom Gesichtspunkt<br />
der Existenzsicherung des Produzenten (Lohnformel), sondern von Gedanken an den<br />
eigenen Profit leiten. Objektiv ist es dabei nicht entscheidend, ob er großer oder kleiner<br />
Verbraucher ist, wenn man auch den Ärmeren, den die Knappheit seiner Mittel zum Billigkauf<br />
treibt, subjektiv eher entschuldigen wird. Doch ist schließlich der Marxschen Theorie<br />
zufolge auch dem Kapitalisten das ausbeuterische Verhalten nicht subjektiv zuzurechnen,<br />
da es ihm die Gesetze der Konkurrenz bei Strafe des Untergangs aufzwingen. Um<br />
so schärfer stellt sich dann <strong>für</strong> Steiner die Frage nach der Ersetzung von Verhältnissen<br />
<strong>und</strong> Einrichtungen, denen solche Zwänge innewohnen, <strong>und</strong> nach der Überwindung von<br />
Vorstellungen <strong>und</strong> Haltungen, die solche Einrichtungen perpetuieren helfen, durch ande-<br />
148<br />
12 GA 340, S. 67f.<br />
13 GA 188, S. 200.<br />
14 Löbl, Wirtschaft am Wendepunkt, S. 240f., zit. nach Huber 1978, S. 46.<br />
15 Geisteswiss. u. <strong>soziale</strong> Frage, in GA 34, S. 206.