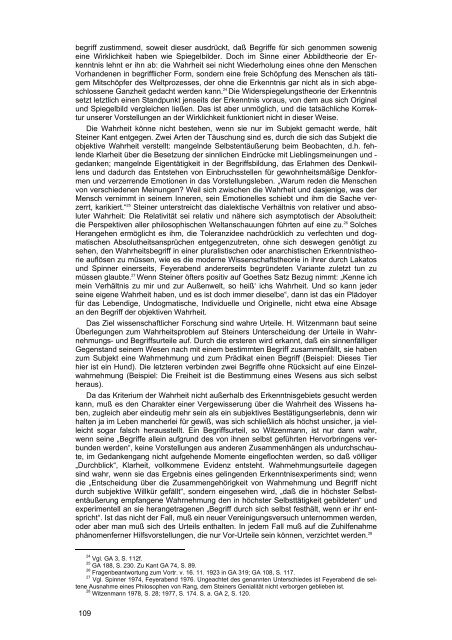Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
egriff zustimmend, soweit dieser ausdrückt, daß Begriffe <strong>für</strong> sich genommen sowenig<br />
eine Wirklichkeit haben wie Spiegelbilder. Doch im Sinne einer Abbildtheorie der Erkenntnis<br />
lehnt er ihn ab: die Wahrheit sei nicht Wiederholung eines ohne den Menschen<br />
Vorhandenen in begrifflicher Form, sondern eine freie Schöpfung des Menschen als tätigem<br />
Mitschöpfer des Weltprozesses, der ohne die Erkenntnis gar nicht als in sich abgeschlossene<br />
Ganzheit gedacht werden kann. 24 Die Widerspiegelungstheorie der Erkenntnis<br />
setzt letztlich einen Standpunkt jenseits der Erkenntnis voraus, von dem aus sich Original<br />
<strong>und</strong> Spiegelbild vergleichen ließen. Das ist aber unmöglich, <strong>und</strong> die tatsächliche Korrektur<br />
unserer Vorstellungen an der Wirklichkeit funktioniert nicht in dieser Weise.<br />
Die Wahrheit könne nicht bestehen, wenn sie nur im Subjekt gemacht werde, hält<br />
Steiner Kant entgegen. Zwei Arten der Täuschung sind es, durch die sich das Subjekt die<br />
objektive Wahrheit verstellt: mangelnde Selbstentäußerung beim Beobachten, d.h. fehlende<br />
Klarheit über die Besetzung der sinnlichen Eindrücke mit Lieblingsmeinungen <strong>und</strong> -<br />
gedanken; mangelnde Eigentätigkeit in der Begriffsbildung, das Erlahmen des Denkwillens<br />
<strong>und</strong> dadurch das Entstehen von Einbruchsstellen <strong>für</strong> gewohnheitsmäßige Denkformen<br />
<strong>und</strong> verzerrende Emotionen in das Vorstellungsleben. „Warum reden die Menschen<br />
von verschiedenen Meinungen? Weil sich zwischen die Wahrheit <strong>und</strong> dasjenige, was der<br />
Mensch vernimmt in seinem Inneren, sein Emotionelles schiebt <strong>und</strong> ihm die Sache verzerrt,<br />
karikiert.“ 25 Steiner unterstreicht das dialektische Verhältnis von relativer <strong>und</strong> absoluter<br />
Wahrheit: Die Relativität sei relativ <strong>und</strong> nähere sich asymptotisch der Absolutheit:<br />
die Perspektiven aller philosophischen Weltanschauungen führten auf eine zu. 26 Solches<br />
Herangehen ermöglicht es ihm, die Toleranzidee nachdrücklich zu verfechten <strong>und</strong> dogmatischen<br />
Absolutheitsansprüchen entgegenzutreten, ohne sich deswegen genötigt zu<br />
sehen, den Wahrheitsbegriff in einer pluralistischen oder anarchistischen Erkenntnistheorie<br />
auflösen zu müssen, wie es die moderne Wissenschaftstheorie in ihrer durch Lakatos<br />
<strong>und</strong> Spinner einerseits, Feyerabend andererseits begründeten Variante zuletzt tun zu<br />
müssen glaubte. 27 Wenn Steiner öfters positiv auf Goethes Satz Bezug nimmt: „Kenne ich<br />
mein Verhältnis zu mir <strong>und</strong> zur Außenwelt, so heiß‘ ichs Wahrheit. Und so kann jeder<br />
seine eigene Wahrheit haben, <strong>und</strong> es ist doch immer dieselbe“, dann ist das ein Plädoyer<br />
<strong>für</strong> das Lebendige, Undogmatische, Individuelle <strong>und</strong> Originelle, nicht etwa eine Absage<br />
an den Begriff der objektiven Wahrheit.<br />
Das Ziel wissenschaftlicher Forschung sind wahre Urteile. H. Witzenmann baut seine<br />
Überlegungen zum Wahrheitsproblem auf Steiners Unterscheidung der Urteile in Wahrnehmungs-<br />
<strong>und</strong> Begriffsurteile auf. Durch die ersteren wird erkannt, daß ein sinnenfälliger<br />
Gegenstand seinem Wesen nach mit einem bestimmten Begriff zusammenfällt, sie haben<br />
zum Subjekt eine Wahrnehmung <strong>und</strong> zum Prädikat einen Begriff (Beispiel: Dieses Tier<br />
hier ist ein H<strong>und</strong>). Die letzteren verbinden zwei Begriffe ohne Rücksicht auf eine Einzelwahrnehmung<br />
(Beispiel: Die Freiheit ist die Bestimmung eines Wesens aus sich selbst<br />
heraus).<br />
Da das Kriterium der Wahrheit nicht außerhalb des Erkenntnisgebiets gesucht werden<br />
kann, muß es den Charakter einer Vergewisserung über die Wahrheit des Wissens haben,<br />
zugleich aber eindeutig mehr sein als ein subjektives Bestätigungserlebnis, denn wir<br />
halten ja im Leben mancherlei <strong>für</strong> gewiß, was sich schließlich als höchst unsicher, ja vielleicht<br />
sogar falsch herausstellt. Ein Begriffsurteil, so Witzenmann, ist nur dann wahr,<br />
wenn seine „Begriffe allein aufgr<strong>und</strong> des von ihnen selbst geführten Hervorbringens verb<strong>und</strong>en<br />
werden“, keine Vorstellungen aus anderen Zusammenhängen als <strong>und</strong>urchschaute,<br />
im Gedankengang nicht aufgehende Momente eingeflochten werden, so daß völliger<br />
„Durchblick“, Klarheit, vollkommene Evidenz entsteht. Wahrnehmungsurteile dagegen<br />
sind wahr, wenn sie das Ergebnis eines gelingenden Erkenntnisexperiments sind; wenn<br />
die „Entscheidung über die Zusammengehörigkeit von Wahrnehmung <strong>und</strong> Begriff nicht<br />
durch subjektive Willkür gefällt“, sondern eingesehen wird, „daß die in höchster Selbstentäußerung<br />
empfangene Wahrnehmung den in höchster Selbsttätigkeit gebildeten“ <strong>und</strong><br />
experimentell an sie herangetragenen „Begriff durch sich selbst festhält, wenn er ihr entspricht“.<br />
Ist das nicht der Fall, muß ein neuer Vereinigungsversuch unternommen werden,<br />
oder aber man muß sich des Urteils enthalten. In jedem Fall muß auf die Zuhilfenahme<br />
phänomenferner Hilfsvorstellungen, die nur Vor-Urteile sein können, verzichtet werden. 28<br />
24 Vgl. GA 3, S. 112f.<br />
25 GA 188, S. 230. Zu Kant GA 74, S. 89.<br />
26 Fragenbeantwortung zum Vortr. v. 16. 11. 1923 in GA 319; GA 108, S. 117.<br />
27 Vgl. Spinner 1974, Feyerabend 1976. Ungeachtet des genannten Unterschiedes ist Feyerabend die seltene<br />
Ausnahme eines Philosophen von Rang, dem Steiners Genialität nicht verborgen geblieben ist.<br />
28 Witzenmann 1978, S. 28; 1977, S. 174. S. a. GA 2, S. 120.<br />
109