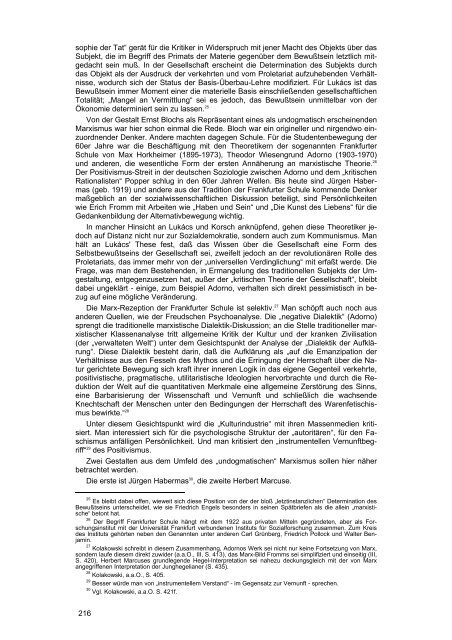Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sophie der Tat“ gerät <strong>für</strong> die Kritiker in Widerspruch mit jener Macht des Objekts über das<br />
Subjekt, die im Begriff des Primats der Materie gegenüber dem Bewußtsein letztlich mitgedacht<br />
sein muß. In der Gesellschaft erscheint die Determination des Subjekts durch<br />
das Objekt als der Ausdruck der verkehrten <strong>und</strong> vom Proletariat aufzuhebenden Verhältnisse,<br />
wodurch sich der Status der Basis-Überbau-Lehre modifiziert. Für Lukács ist das<br />
Bewußtsein immer Moment einer die materielle Basis einschließenden gesellschaftlichen<br />
Totalität; „Mangel an Vermittlung“ sei es jedoch, das Bewußtsein unmittelbar von der<br />
Ökonomie determiniert sein zu lassen. 25<br />
Von der Gestalt Ernst Blochs als Repräsentant eines als <strong>und</strong>ogmatisch erscheinenden<br />
<strong>Marxismus</strong> war hier schon einmal die Rede. Bloch war ein origineller <strong>und</strong> nirgendwo einzuordnender<br />
Denker. Andere machten dagegen Schule. Für die Studentenbewegung der<br />
60er Jahre war die Beschäftigung mit den Theoretikern der sogenannten Frankfurter<br />
Schule von Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengr<strong>und</strong> Adorno (1903-1970)<br />
<strong>und</strong> anderen, die wesentliche Form der ersten Annäherung an marxistische Theorie. 26<br />
Der Positivismus-Streit in der deutschen Soziologie zwischen Adorno <strong>und</strong> dem „kritischen<br />
Rationalisten“ Popper schlug in den 60er Jahren Wellen. Bis heute sind Jürgen Habermas<br />
(geb. 1919) <strong>und</strong> andere aus der Tradition der Frankfurter Schule kommende Denker<br />
maßgeblich an der sozialwissenschaftlichen Diskussion beteiligt, sind Persönlichkeiten<br />
wie Erich Fromm mit Arbeiten wie „Haben <strong>und</strong> Sein“ <strong>und</strong> „Die Kunst des Liebens“ <strong>für</strong> die<br />
Gedankenbildung der Alternativbewegung wichtig.<br />
In mancher Hinsicht an Lukács <strong>und</strong> Korsch anknüpfend, gehen diese Theoretiker jedoch<br />
auf Distanz nicht nur zur Sozialdemokratie, sondern auch zum Kommunismus. Man<br />
hält an Lukács' These fest, daß das Wissen über die Gesellschaft eine Form des<br />
Selbstbewußtseins der Gesellschaft sei, zweifelt jedoch an der revolutionären Rolle des<br />
Proletariats, das immer mehr von der „universellen Verdinglichung“ mit erfaßt werde. Die<br />
Frage, was man dem Bestehenden, in Ermangelung des traditionellen Subjekts der Umgestaltung,<br />
entgegenzusetzen hat, außer der „kritischen Theorie der Gesellschaft“, bleibt<br />
dabei ungeklärt - einige, zum Beispiel Adorno, verhalten sich direkt pessimistisch in bezug<br />
auf eine mögliche Veränderung.<br />
Die Marx-Rezeption der Frankfurter Schule ist selektiv. 27 Man schöpft auch noch aus<br />
anderen Quellen, wie der Freudschen Psychoanalyse. Die „negative Dialektik“ (Adorno)<br />
sprengt die traditionelle marxistische Dialektik-Diskussion; an die Stelle traditioneller marxistischer<br />
Klassenanalyse tritt allgemeine Kritik der Kultur <strong>und</strong> der kranken Zivilisation<br />
(der „verwalteten Welt“) unter dem Gesichtspunkt der Analyse der „Dialektik der Aufklärung“.<br />
Diese Dialektik besteht darin, daß die Aufklärung als „auf die Emanzipation der<br />
Verhältnisse aus den Fesseln des Mythos <strong>und</strong> die Erringung der Herrschaft über die Natur<br />
gerichtete Bewegung sich kraft ihrer inneren Logik in das eigene Gegenteil verkehrte,<br />
positivistische, pragmatische, utilitaristische Ideologien hervorbrachte <strong>und</strong> durch die Reduktion<br />
der Welt auf die quantitativen Merkmale eine allgemeine Zerstörung des Sinns,<br />
eine Barbarisierung der Wissenschaft <strong>und</strong> Vernunft <strong>und</strong> schließlich die wachsende<br />
Knechtschaft der Menschen unter den Bedingungen der Herrschaft des Warenfetischismus<br />
bewirkte.“ 28<br />
Unter diesem Gesichtspunkt wird die „Kulturindustrie“ mit ihren Massenmedien kritisiert.<br />
Man interessiert sich <strong>für</strong> die psychologische Struktur der „autoritären“, <strong>für</strong> den Faschismus<br />
anfälligen Persönlichkeit. Und man kritisiert den „instrumentellen Vernunftbegriff“<br />
29 des Positivismus.<br />
Zwei Gestalten aus dem Umfeld des „<strong>und</strong>ogmatischen“ <strong>Marxismus</strong> sollen hier näher<br />
betrachtet werden.<br />
Die erste ist Jürgen Habermas 30 , die zweite Herbert Marcuse.<br />
25 Es bleibt dabei offen, wieweit sich diese Position von der der bloß „letztinstanzlichen“ Determination des<br />
Bewußtseins unterscheidet, wie sie Friedrich Engels besonders in seinen Spätbriefen als die allein „marxistische“<br />
betont hat.<br />
26 Der Begriff Frankfurter Schule hängt mit dem 1922 aus privaten Mitteln gegründeten, aber als Forschungsinstitut<br />
mit der Universität Frankfurt verb<strong>und</strong>enen <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Sozialforschung zusammen. Zum Kreis<br />
des <strong>Institut</strong>s gehörten neben den Genannten unter anderen Carl Grünberg, Friedrich Pollock <strong>und</strong> Walter Benjamin.<br />
27 Kolakowski schreibt in diesem Zusammenhang, Adornos Werk sei nicht nur keine Fortsetzung von Marx,<br />
sondern laufe diesem direkt zuwider (a.a.O., III, S. 413), das Marx-Bild Fromms sei simplifiziert <strong>und</strong> einseitig (III,<br />
S. 420), Herbert Marcuses gr<strong>und</strong>legende Hegel-Interpretation sei nahezu deckungsgleich mit der von Marx<br />
angegriffenen Interpretation der Junghegelianer (S. 435).<br />
28 Kolakowski, a.a.O., S. 405.<br />
29 Besser würde man von „instrumentellem Verstand“ - im Gegensatz zur Vernunft - sprechen.<br />
216<br />
30 Vgl. Kolakowski, a.a.O. S. 421f.