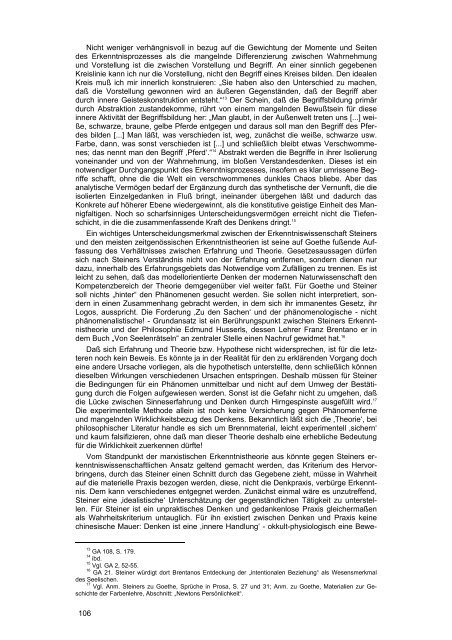Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nicht weniger verhängnisvoll in bezug auf die Gewichtung der Momente <strong>und</strong> Seiten<br />
des Erkenntnisprozesses als die mangelnde Differenzierung zwischen Wahrnehmung<br />
<strong>und</strong> Vorstellung ist die zwischen Vorstellung <strong>und</strong> Begriff. An einer sinnlich gegebenen<br />
Kreislinie kann ich nur die Vorstellung, nicht den Begriff eines Kreises bilden. Den idealen<br />
Kreis muß ich mir innerlich konstruieren: „Sie haben also den Unterschied zu machen,<br />
daß die Vorstellung gewonnen wird an äußeren Gegenständen, daß der Begriff aber<br />
durch innere Geisteskonstruktion entsteht.“ 13 Der Schein, daß die Begriffsbildung primär<br />
durch Abstraktion zustandekomme, rührt von einem mangelnden Bewußtsein <strong>für</strong> diese<br />
innere Aktivität der Begriffsbildung her: „Man glaubt, in der Außenwelt treten uns [...] weiße,<br />
schwarze, braune, gelbe Pferde entgegen <strong>und</strong> daraus soll man den Begriff des Pferdes<br />
bilden [...] Man läßt, was verschieden ist, weg, zunächst die weiße, schwarze usw.<br />
Farbe, dann, was sonst verschieden ist [...] <strong>und</strong> schließlich bleibt etwas Verschwommenes;<br />
das nennt man den Begriff ,Pferd‘.“ 14 Abstrakt werden die Begriffe in ihrer Isolierung<br />
voneinander <strong>und</strong> von der Wahrnehmung, im bloßen Verstandesdenken. Dieses ist ein<br />
notwendiger Durchgangspunkt des Erkenntnisprozesses, insofern es klar umrissene Begriffe<br />
schafft, ohne die die Welt ein verschwommenes dunkles Chaos bliebe. Aber das<br />
analytische Vermögen bedarf der Ergänzung durch das synthetische der Vernunft, die die<br />
isolierten Einzelgedanken in Fluß bringt, ineinander übergehen läßt <strong>und</strong> dadurch das<br />
Konkrete auf höherer Ebene wiedergewinnt, als die konstitutive geistige Einheit des Mannigfaltigen.<br />
Noch so scharfsinniges Unterscheidungsvermögen erreicht nicht die Tiefenschicht,<br />
in die die zusammenfassende Kraft des Denkens dringt. 15<br />
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen der Erkenntniswissenschaft Steiners<br />
<strong>und</strong> den meisten zeitgenössischen Erkenntnistheorien ist seine auf Goethe fußende Auffassung<br />
des Verhältnisses zwischen Erfahrung <strong>und</strong> Theorie. Gesetzesaussagen dürfen<br />
sich nach Steiners Verständnis nicht von der Erfahrung entfernen, sondern dienen nur<br />
dazu, innerhalb des Erfahrungsgebiets das Notwendige vom Zufälligen zu trennen. Es ist<br />
leicht zu sehen, daß das modellorientierte Denken der modernen Naturwissenschaft den<br />
Kompetenzbereich der Theorie demgegenüber viel weiter faßt. Für Goethe <strong>und</strong> Steiner<br />
soll nichts „hinter“ den Phänomenen gesucht werden. Sie sollen nicht interpretiert, sondern<br />
in einen Zusammenhang gebracht werden, in dem sich ihr immanentes Gesetz, ihr<br />
Logos, ausspricht. Die Forderung ‚Zu den Sachen‘ <strong>und</strong> der phänomenologische - nicht<br />
phänomenalistische! - Gr<strong>und</strong>ansatz ist ein Berührungspunkt zwischen Steiners Erkenntnistheorie<br />
<strong>und</strong> der Philosophie Edm<strong>und</strong> Husserls, dessen Lehrer Franz Brentano er in<br />
dem Buch „Von Seelenrätseln“ an zentraler Stelle einen Nachruf gewidmet hat. 16<br />
Daß sich Erfahrung <strong>und</strong> Theorie bzw. Hypothese nicht widersprechen, ist <strong>für</strong> die letzteren<br />
noch kein Beweis. Es könnte ja in der Realität <strong>für</strong> den zu erklärenden Vorgang doch<br />
eine andere Ursache vorliegen, als die hypothetisch unterstellte, denn schließlich können<br />
dieselben Wirkungen verschiedenen Ursachen entspringen. Deshalb müssen <strong>für</strong> Steiner<br />
die Bedingungen <strong>für</strong> ein Phänomen unmittelbar <strong>und</strong> nicht auf dem Umweg der Bestätigung<br />
durch die Folgen aufgewiesen werden. Sonst ist die Gefahr nicht zu umgehen, daß<br />
die Lücke zwischen Sinneserfahrung <strong>und</strong> Denken durch Hirngespinste ausgefüllt wird. 17<br />
Die experimentelle Methode allein ist noch keine Versicherung gegen Phänomenferne<br />
<strong>und</strong> mangelnden Wirklichkeitsbezug des Denkens. Bekanntlich läßt sich die ‚Theorie‘, bei<br />
philosophischer Literatur handle es sich um Brennmaterial, leicht experimentell ‚sichern‘<br />
<strong>und</strong> kaum falsifizieren, ohne daß man dieser Theorie deshalb eine erhebliche Bedeutung<br />
<strong>für</strong> die Wirklichkeit zuerkennen dürfte!<br />
Vom Standpunkt der marxistischen Erkenntnistheorie aus könnte gegen Steiners erkenntniswissenschaftlichen<br />
Ansatz geltend gemacht werden, das Kriterium des Hervorbringens,<br />
durch das Steiner einen Schnitt durch das Gegebene zieht, müsse in Wahrheit<br />
auf die materielle Praxis bezogen werden, diese, nicht die Denkpraxis, verbürge Erkenntnis.<br />
Dem kann verschiedenes entgegnet werden. Zunächst einmal wäre es unzutreffend,<br />
Steiner eine ‚idealistische‘ Unterschätzung der gegenständlichen Tätigkeit zu unterstellen.<br />
Für Steiner ist ein unpraktisches Denken <strong>und</strong> gedankenlose Praxis gleichermaßen<br />
als Wahrheitskriterium untauglich. Für ihn existiert zwischen Denken <strong>und</strong> Praxis keine<br />
chinesische Mauer: Denken ist eine ,innere Handlung‘ - okkult-physiologisch eine Bewe-<br />
13<br />
GA 108, S. 179.<br />
14<br />
ibd.<br />
15<br />
Vgl. GA 2, 52-55.<br />
16<br />
GA 21. Steiner würdigt dort Brentanos Entdeckung der „intentionalen Beziehung“ als Wesensmerkmal<br />
des Seelischen.<br />
17<br />
Vgl. Anm. Steiners zu Goethe, Sprüche in Prosa, S. 27 <strong>und</strong> 31; Anm. zu Goethe, Materialien zur Geschichte<br />
der Farbenlehre, Abschnitt: „Newtons Persönlichkeit“.<br />
106