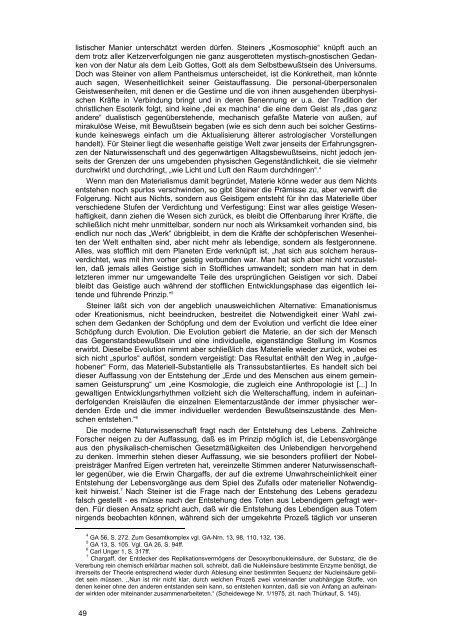Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
listischer Manier unterschätzt werden dürfen. Steiners „Kosmosophie“ knüpft auch an<br />
dem trotz aller Ketzerverfolgungen nie ganz ausgerotteten mystisch-gnostischen Gedanken<br />
von der Natur als dem Leib Gottes, Gott als dem Selbstbewußtsein des Universums.<br />
Doch was Steiner von allem Pantheismus unterscheidet, ist die Konkretheit, man könnte<br />
auch sagen, Wesenheitlichkeit seiner Geistauffassung. Die personal-überpersonalen<br />
Geistwesenheiten, mit denen er die Gestirne <strong>und</strong> die von ihnen ausgehenden überphysischen<br />
Kräfte in Verbindung bringt <strong>und</strong> in deren Benennung er u.a. der Tradition der<br />
christlichen Esoterik folgt, sind keine „dei ex machina“ die eine dem Geist als „das ganz<br />
andere“ dualistisch gegenüberstehende, mechanisch gefaßte Materie von außen, auf<br />
mirakulöse Weise, mit Bewußtsein begaben (wie es sich denn auch bei solcher Gestirnsk<strong>und</strong>e<br />
keineswegs einfach um die Aktualisierung älterer astrologischer Vorstellungen<br />
handelt). Für Steiner liegt die wesenhafte geistige Welt zwar jenseits der Erfahrungsgrenzen<br />
der Naturwissenschaft <strong>und</strong> des gegenwärtigen Alltagsbewußtseins, nicht jedoch jenseits<br />
der Grenzen der uns umgebenden physischen Gegenständlichkeit, die sie vielmehr<br />
durchwirkt <strong>und</strong> durchdringt, „wie Licht <strong>und</strong> Luft den Raum durchdringen“. 4<br />
Wenn man den Materialismus damit begründet, Materie könne weder aus dem Nichts<br />
entstehen noch spurlos verschwinden, so gibt Steiner die Prämisse zu, aber verwirft die<br />
Folgerung. Nicht aus Nichts, sondern aus Geistigem entsteht <strong>für</strong> ihn das Materielle über<br />
verschiedene Stufen der Verdichtung <strong>und</strong> Verfestigung: Einst war alles geistige Wesenhaftigkeit,<br />
dann ziehen die Wesen sich zurück, es bleibt die Offenbarung ihrer Kräfte, die<br />
schließlich nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch als Wirksamkeit vorhanden sind, bis<br />
endlich nur noch das „Werk“ übrigbleibt, in dem die Kräfte der schöpferischen Wesenheiten<br />
der Welt enthalten sind, aber nicht mehr als lebendige, sondern als festgeronnene.<br />
Alles, was stofflich mit dem Planeten Erde verknüpft ist, „hat sich aus solchem herausverdichtet,<br />
was mit ihm vorher geistig verb<strong>und</strong>en war. Man hat sich aber nicht vorzustellen,<br />
daß jemals alles Geistige sich in Stoffliches umwandelt; sondern man hat in dem<br />
letzteren immer nur umgewandelte Teile des ursprünglichen Geistigen vor sich. Dabei<br />
bleibt das Geistige auch während der stofflichen Entwicklungsphase das eigentlich leitende<br />
<strong>und</strong> führende Prinzip.“ 5<br />
Steiner läßt sich von der angeblich unausweichlichen Alternative: Emanationismus<br />
oder Kreationismus, nicht beeindrucken, bestreitet die Notwendigkeit einer Wahl zwischen<br />
dem Gedanken der Schöpfung <strong>und</strong> dem der Evolution <strong>und</strong> verficht die Idee einer<br />
Schöpfung durch Evolution. Die Evolution gebiert die Materie, an der sich der Mensch<br />
das Gegenstandsbewußtsein <strong>und</strong> eine individuelle, eigenständige Stellung im Kosmos<br />
erwirbt. Dieselbe Evolution nimmt aber schließlich das Materielle wieder zurück, wobei es<br />
sich nicht „spurlos“ auflöst, sondern vergeistigt: Das Resultat enthält den Weg in „aufgehobener“<br />
Form, das Materiell-Substantielle als Transsubstantiiertes. Es handelt sich bei<br />
dieser Auffassung von der Entstehung der „Erde <strong>und</strong> des Menschen aus einem gemeinsamen<br />
Geistursprung“ um „eine Kosmologie, die zugleich eine Anthropologie ist [...] In<br />
gewaltigen Entwicklungsrhythmen vollzieht sich die Welterschaffung, indem in aufeinanderfolgenden<br />
Kreisläufen die einzelnen Elementarzustände der immer physischer werdenden<br />
Erde <strong>und</strong> die immer individueller werdenden Bewußtseinszustände des Menschen<br />
entstehen.“ 6<br />
Die moderne Naturwissenschaft fragt nach der Entstehung des Lebens. Zahlreiche<br />
Forscher neigen zu der Auffassung, daß es im Prinzip möglich ist, die Lebensvorgänge<br />
aus den physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten des Unlebendigen hervorgehend<br />
zu denken. Immerhin stehen dieser Auffassung, wie sie besonders profiliert der Nobelpreisträger<br />
Manfred Eigen vertreten hat, vereinzelte Stimmen anderer Naturwissenschaftler<br />
gegenüber, wie die Erwin Chargaffs, der auf die extreme Unwahrscheinlichkeit einer<br />
Entstehung der Lebensvorgänge aus dem Spiel des Zufalls oder materieller Notwendigkeit<br />
hinweist. 7 Nach Steiner ist die Frage nach der Entstehung des Lebens geradezu<br />
falsch gestellt - es müsse nach der Entstehung des Toten aus Lebendigem gefragt werden.<br />
Für diesen Ansatz spricht auch, daß wir die Entstehung des Lebendigen aus Totem<br />
nirgends beobachten können, während sich der umgekehrte Prozeß täglich vor unseren<br />
4<br />
GA 56, S. 272. Zum Gesamtkomplex vgl. GA-Nrn. 13, 98, 110, 132, 136.<br />
5<br />
GA 13, S. 105. Vgl. GA 26, S. 94ff.<br />
6<br />
Carl Unger 1, S. 317ff.<br />
7<br />
Chargaff, der Entdecker des Replikationsvermögens der Desoxyribonukleinsäure, der Substanz, die die<br />
Vererbung rein chemisch erklärbar machen soll, schreibt, daß die Nukleinsäure bestimmte Enzyme benötigt, die<br />
ihrerseits der Theorie entsprechend wieder durch Ablesung einer bestimmten Sequenz der Nucleinsäure gebildet<br />
sein müssen. ,,Nun ist mir nicht klar, durch welchen Prozeß zwei voneinander unabhängige Stoffe, von<br />
denen keiner ohne den anderen entstanden sein kann, so entstehen konnten, daß sie von Anfang an aufeinander<br />
wirkten oder miteinander zusammenarbeiteten.“ (Scheidewege Nr. 1/1975, zit. nach Thürkauf, S. 145).<br />
49