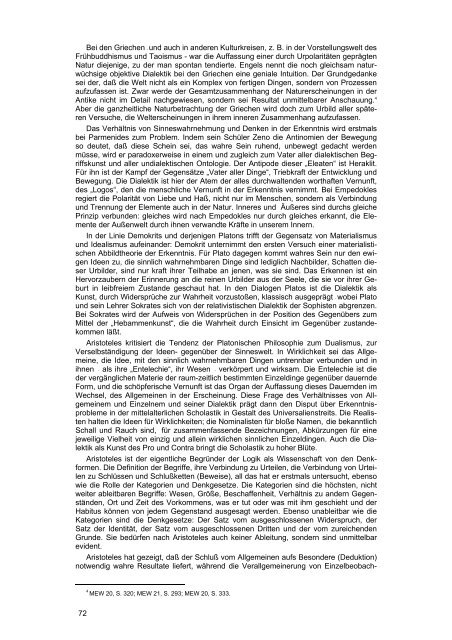Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bei den Griechen - <strong>und</strong> auch in anderen Kulturkreisen, z. B. in der Vorstellungswelt des<br />
Frühbuddhismus <strong>und</strong> Taoismus - war die Auffassung einer durch Urpolaritäten geprägten<br />
Natur diejenige, zu der man spontan tendierte. Engels nennt die noch gleichsam naturwüchsige<br />
objektive Dialektik bei den Griechen eine geniale Intuition. Der Gr<strong>und</strong>gedanke<br />
sei der, daß die Welt nicht als ein Komplex von fertigen Dingen, sondern von Prozessen<br />
aufzufassen ist. Zwar werde der Gesamtzusammenhang der Naturerscheinungen in der<br />
Antike nicht im Detail nachgewiesen, sondern sei Resultat unmittelbarer Anschauung. 4<br />
Aber die ganzheitliche Naturbetrachtung der Griechen wird doch zum Urbild aller späteren<br />
Versuche, die Welterscheinungen in ihrem inneren Zusammenhang aufzufassen.<br />
Das Verhältnis von Sinneswahrnehmung <strong>und</strong> Denken in der Erkenntnis wird erstmals<br />
bei Parmenides zum Problem. Indem sein Schüler Zeno die Antinomien der Bewegung<br />
so deutet, daß diese Schein sei, das wahre Sein ruhend, unbewegt gedacht werden<br />
müsse, wird er paradoxerweise in einem <strong>und</strong> zugleich zum Vater aller dialektischen Begriffskunst<br />
<strong>und</strong> aller <strong>und</strong>ialektischen Ontologie. Der Antipode dieser „Eleaten“ ist Heraklit.<br />
Für ihn ist der Kampf der Gegensätze „Vater aller Dinge“, Triebkraft der Entwicklung <strong>und</strong><br />
Bewegung. Die Dialektik ist hier der Atem der alles durchwaltenden worthaften Vernunft,<br />
des „Logos“, den die menschliche Vernunft in der Erkenntnis vernimmt. Bei Empedokles<br />
regiert die Polarität von Liebe <strong>und</strong> Haß, nicht nur im Menschen, sondern als Verbindung<br />
<strong>und</strong> Trennung der Elemente auch in der Natur. Inneres <strong>und</strong> Äußeres sind durchs gleiche<br />
Prinzip verb<strong>und</strong>en: gleiches wird nach Empedokles nur durch gleiches erkannt, die Elemente<br />
der Außenwelt durch ihnen verwandte Kräfte in unserem Innern.<br />
In der Linie Demokrits <strong>und</strong> derjenigen Platons trifft der Gegensatz von Materialismus<br />
<strong>und</strong> Idealismus aufeinander: Demokrit unternimmt den ersten Versuch einer materialistischen<br />
Abbildtheorie der Erkenntnis. Für Plato dagegen kommt wahres Sein nur den ewigen<br />
Ideen zu, die sinnlich wahrnehmbaren Dinge sind lediglich Nachbilder, Schatten dieser<br />
Urbilder, sind nur kraft ihrer Teilhabe an jenen, was sie sind. Das Erkennen ist ein<br />
Hervorzaubern der Erinnerung an die reinen Urbilder aus der Seele, die sie vor ihrer Geburt<br />
in leibfreiem Zustande geschaut hat. In den Dialogen Platos ist die Dialektik als<br />
Kunst, durch Widersprüche zur Wahrheit vorzustoßen, klassisch ausgeprägt - wobei Plato<br />
<strong>und</strong> sein Lehrer Sokrates sich von der relativistischen Dialektik der Sophisten abgrenzen.<br />
Bei Sokrates wird der Aufweis von Widersprüchen in der Position des Gegenübers zum<br />
Mittel der „Hebammenkunst“, die die Wahrheit durch Einsicht im Gegenüber zustandekommen<br />
läßt.<br />
Aristoteles kritisiert die Tendenz der Platonischen Philosophie zum Dualismus, zur<br />
Verselbständigung der Ideen- gegenüber der Sinneswelt. In Wirklichkeit sei das Allgemeine,<br />
die Idee, mit den sinnlich wahrnehmbaren Dingen untrennbar verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> in<br />
ihnen - als ihre „Entelechie“, ihr Wesen - verkörpert <strong>und</strong> wirksam. Die Entelechie ist die<br />
der vergänglichen Materie der raum-zeitlich bestimmten Einzeldinge gegenüber dauernde<br />
Form, <strong>und</strong> die schöpferische Vernunft ist das Organ der Auffassung dieses Dauernden im<br />
Wechsel, des Allgemeinen in der Erscheinung. Diese Frage des Verhältnisses von Allgemeinem<br />
<strong>und</strong> Einzelnem <strong>und</strong> seiner Dialektik prägt dann den Disput über Erkenntnisprobleme<br />
in der mittelalterlichen Scholastik in Gestalt des Universalienstreits. Die Realisten<br />
halten die Ideen <strong>für</strong> Wirklichkeiten; die Nominalisten <strong>für</strong> bloße Namen, die bekanntlich<br />
Schall <strong>und</strong> Rauch sind, <strong>für</strong> zusammenfassende Bezeichnungen, Abkürzungen <strong>für</strong> eine<br />
jeweilige Vielheit von einzig <strong>und</strong> allein wirklichen sinnlichen Einzeldingen. Auch die Dialektik<br />
als Kunst des Pro <strong>und</strong> Contra bringt die Scholastik zu hoher Blüte.<br />
Aristoteles ist der eigentliche Begründer der Logik als Wissenschaft von den Denkformen.<br />
Die Definition der Begriffe, ihre Verbindung zu Urteilen, die Verbindung von Urteilen<br />
zu Schlüssen <strong>und</strong> Schlußketten (Beweise), all das hat er erstmals untersucht, ebenso<br />
wie die Rolle der Kategorien <strong>und</strong> Denkgesetze. Die Kategorien sind die höchsten, nicht<br />
weiter ableitbaren Begriffe: Wesen, Größe, Beschaffenheit, Verhältnis zu andern Gegenständen,<br />
Ort <strong>und</strong> Zeit des Vorkommens, was er tut oder was mit ihm geschieht <strong>und</strong> der<br />
Habitus können von jedem Gegenstand ausgesagt werden. Ebenso unableitbar wie die<br />
Kategorien sind die Denkgesetze: Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch, der<br />
Satz der Identität, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten <strong>und</strong> der vom zureichenden<br />
Gr<strong>und</strong>e. Sie bedürfen nach Aristoteles auch keiner Ableitung, sondern sind unmittelbar<br />
evident.<br />
Aristoteles hat gezeigt, daß der Schluß vom Allgemeinen aufs Besondere (Deduktion)<br />
notwendig wahre Resultate liefert, während die Verallgemeinerung von Einzelbeobach-<br />
72<br />
4 MEW 20, S. 320; MEW 21, S. 293; MEW 20, S. 333.