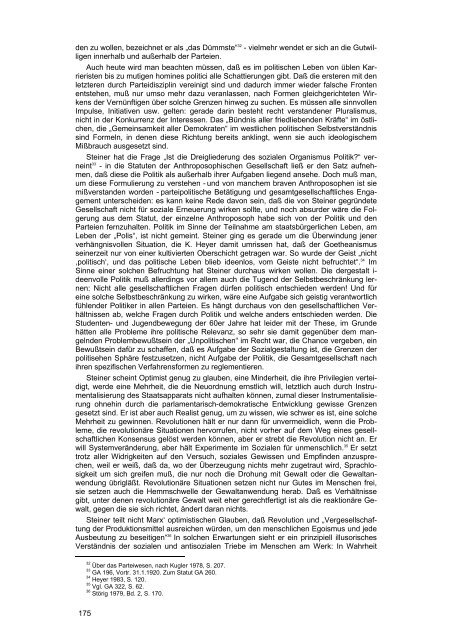Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
den zu wollen, bezeichnet er als „das Dümmste“ 32 - vielmehr wendet er sich an die Gutwilligen<br />
innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der Parteien.<br />
Auch heute wird man beachten müssen, daß es im politischen Leben von üblen Karrieristen<br />
bis zu mutigen homines politici alle Schattierungen gibt. Daß die ersteren mit den<br />
letzteren durch Parteidisziplin vereinigt sind <strong>und</strong> dadurch immer wieder falsche Fronten<br />
entstehen, muß nur umso mehr dazu veranlassen, nach Formen gleichgerichteten Wirkens<br />
der Vernünftigen über solche Grenzen hinweg zu suchen. Es müssen alle sinnvollen<br />
Impulse, Initiativen usw. gelten: gerade darin besteht recht verstandener Pluralismus,<br />
nicht in der Konkurrenz der Interessen. Das „Bündnis aller friedliebenden Kräfte“ im östlichen,<br />
die „Gemeinsamkeit aller Demokraten“ im westlichen politischen Selbstverständnis<br />
sind Formeln, in denen diese Richtung bereits anklingt, wenn sie auch ideologischem<br />
Mißbrauch ausgesetzt sind.<br />
Steiner hat die Frage „Ist die Dreigliederung des <strong>soziale</strong>n Organismus Politik?“ verneint<br />
33 - in die Statuten der Anthroposophischen Gesellschaft ließ er den Satz aufnehmen,<br />
daß diese die Politik als außerhalb ihrer Aufgaben liegend ansehe. Doch muß man,<br />
um diese Formulierung zu verstehen - <strong>und</strong> von manchem braven Anthroposophen ist sie<br />
mißverstanden worden - parteipolitische Betätigung <strong>und</strong> gesamtgesellschaftliches Engagement<br />
unterscheiden: es kann keine Rede davon sein, daß die von Steiner gegründete<br />
Gesellschaft nicht <strong>für</strong> <strong>soziale</strong> Erneuerung wirken sollte, <strong>und</strong> noch absurder wäre die Folgerung<br />
aus dem Statut, der einzelne Anthroposoph habe sich von der Politik <strong>und</strong> den<br />
Parteien fernzuhalten. Politik im Sinne der Teilnahme am staatsbürgerlichen Leben, am<br />
Leben der „Polis“, ist nicht gemeint. Steiner ging es gerade um die Überwindung jener<br />
verhängnisvollen Situation, die K. Heyer damit umrissen hat, daß der Goetheanismus<br />
seinerzeit nur von einer kultivierten Oberschicht getragen war. So wurde der Geist „nicht<br />
,politisch‘, <strong>und</strong> das politische Leben blieb ideenlos, vom Geiste nicht befruchtet“. 34 Im<br />
Sinne einer solchen Befruchtung hat Steiner durchaus wirken wollen. Die dergestalt ideenvolle<br />
Politik muß allerdings vor allem auch die Tugend der Selbstbeschränkung lernen:<br />
Nicht alle gesellschaftlichen Fragen dürfen politisch entschieden werden! Und <strong>für</strong><br />
eine solche Selbstbeschränkung zu wirken, wäre eine Aufgabe sich geistig verantwortlich<br />
fühlender Politiker in allen Parteien. Es hängt durchaus von den gesellschaftlichen Verhältnissen<br />
ab, welche Fragen durch Politik <strong>und</strong> welche anders entschieden werden. Die<br />
Studenten- <strong>und</strong> Jugendbewegung der 60er Jahre hat leider mit der These, im Gr<strong>und</strong>e<br />
hätten alle Probleme ihre politische Relevanz, so sehr sie damit gegenüber dem mangelnden<br />
Problembewußtsein der „Unpolitischen“ im Recht war, die Chance vergeben, ein<br />
Bewußtsein da<strong>für</strong> zu schaffen, daß es Aufgabe der Sozialgestaltung ist, die Grenzen der<br />
politisehen Sphäre festzusetzen, nicht Aufgabe der Politik, die Gesamtgesellschaft nach<br />
ihren spezifischen Verfahrensformen zu reglementieren.<br />
Steiner scheint Optimist genug zu glauben, eine Minderheit, die ihre Privilegien verteidigt,<br />
werde eine Mehrheit, die die Neuordnung ernstlich will, letztlich auch durch Instrumentalisierung<br />
des Staatsapparats nicht aufhalten können, zumal dieser Instrumentalisierung<br />
ohnehin durch die parlamentarisch-demokratische Entwicklung gewisse Grenzen<br />
gesetzt sind. Er ist aber auch Realist genug, um zu wissen, wie schwer es ist, eine solche<br />
Mehrheit zu gewinnen. Revolutionen hält er nur dann <strong>für</strong> unvermeidlich, wenn die Probleme,<br />
die revolutionäre Situationen hervorrufen, nicht vorher auf dem Weg eines gesellschaftlichen<br />
Konsensus gelöst werden können, aber er strebt die Revolution nicht an. Er<br />
will Systemveränderung, aber hält Experimente im Sozialen <strong>für</strong> unmenschlich. 35 Er setzt<br />
trotz aller Widrigkeiten auf den Versuch, <strong>soziale</strong>s Gewissen <strong>und</strong> Empfinden anzusprechen,<br />
weil er weiß, daß da, wo der Überzeugung nichts mehr zugetraut wird, Sprachlosigkeit<br />
um sich greifen muß, die nur noch die Drohung mit Gewalt oder die Gewaltanwendung<br />
übrigläßt. Revolutionäre Situationen setzen nicht nur Gutes im Menschen frei,<br />
sie setzen auch die Hemmschwelle der Gewaltanwendung herab. Daß es Verhältnisse<br />
gibt, unter denen revolutionäre Gewalt weit eher gerechtfertigt ist als die reaktionäre Gewalt,<br />
gegen die sie sich richtet, ändert daran nichts.<br />
Steiner teilt nicht Marx‘ optimistischen Glauben, daß Revolution <strong>und</strong> „Vergesellschaftung<br />
der Produktionsmittel ausreichen würden, um den menschlichen Egoismus <strong>und</strong> jede<br />
Ausbeutung zu beseitigen“ 36 In solchen Erwartungen sieht er ein prinzipiell illusorisches<br />
Verständnis der <strong>soziale</strong>n <strong>und</strong> anti<strong>soziale</strong>n Triebe im Menschen am Werk: In Wahrheit<br />
32<br />
Über das Parteiwesen, nach Kugler 1978, S. 207.<br />
33<br />
GA 196, Vortr. 31.1.1920. Zum Statut GA 260.<br />
34<br />
Heyer 1983, S. 120.<br />
35<br />
Vgl. GA 322, S. 62.<br />
36<br />
Störig 1979, Bd. 2, S. 170.<br />
175