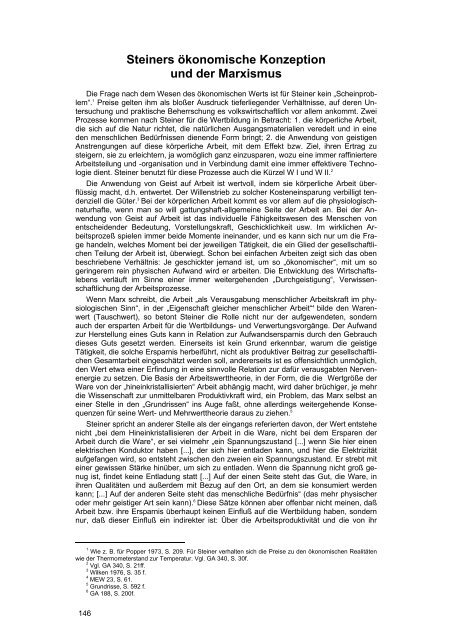Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
146<br />
Steiners ökonomische Konzeption<br />
<strong>und</strong> der <strong>Marxismus</strong><br />
Die Frage nach dem Wesen des ökonomischen Werts ist <strong>für</strong> Steiner kein „Scheinproblem“.<br />
1 Preise gelten ihm als bloßer Ausdruck tieferliegender Verhältnisse, auf deren Untersuchung<br />
<strong>und</strong> praktische Beherrschung es volkswirtschaftlich vor allem ankommt. Zwei<br />
Prozesse kommen nach Steiner <strong>für</strong> die Wertbildung in Betracht: 1. die körperliche Arbeit,<br />
die sich auf die Natur richtet, die natürlichen Ausgangsmaterialien veredelt <strong>und</strong> in eine<br />
den menschlichen Bedürfnissen dienende Form bringt; 2. die Anwendung von geistigen<br />
Anstrengungen auf diese körperliche Arbeit, mit dem Effekt bzw. Ziel, ihren Ertrag zu<br />
steigern, sie zu erleichtern, ja womöglich ganz einzusparen, wozu eine immer raffiniertere<br />
Arbeitsteilung <strong>und</strong> -organisation <strong>und</strong> in Verbindung damit eine immer effektivere Technologie<br />
dient. Steiner benutzt <strong>für</strong> diese Prozesse auch die Kürzel W I <strong>und</strong> W II. 2<br />
Die Anwendung von Geist auf Arbeit ist wertvoll, indem sie körperliche Arbeit überflüssig<br />
macht, d.h. entwertet. Der Willenstrieb zu solcher Kosteneinsparung verbilligt tendenziell<br />
die Güter. 3 Bei der körperlichen Arbeit kommt es vor allem auf die physiologischnaturhafte,<br />
wenn man so will gattungshaft-allgemeine Seite der Arbeit an. Bei der Anwendung<br />
von Geist auf Arbeit ist das individuelle Fähigkeitswesen des Menschen von<br />
entscheidender Bedeutung, Vorstellungskraft, Geschicklichkeit usw. Im wirklichen Arbeitsprozeß<br />
spielen immer beide Momente ineinander, <strong>und</strong> es kann sich nur um die Frage<br />
handeln, welches Moment bei der jeweiligen Tätigkeit, die ein Glied der gesellschaftlichen<br />
Teilung der Arbeit ist, überwiegt. Schon bei einfachen Arbeiten zeigt sich das oben<br />
beschriebene Verhältnis: Je geschickter jemand ist, um so „ökonomischer“, mit um so<br />
geringerem rein physischen Aufwand wird er arbeiten. Die Entwicklung des Wirtschaftslebens<br />
verläuft im Sinne einer immer weitergehenden „Durchgeistigung“, Verwissenschaftlichung<br />
der Arbeitsprozesse.<br />
Wenn Marx schreibt, die Arbeit „als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen<br />
Sinn“, in der „Eigenschaft gleicher menschlicher Arbeit“ 4 bilde den Warenwert<br />
(Tauschwert), so betont Steiner die Rolle nicht nur der aufgewendeten, sondern<br />
auch der ersparten Arbeit <strong>für</strong> die Wertbildungs- <strong>und</strong> Verwertungsvorgänge. Der Aufwand<br />
zur Herstellung eines Guts kann in Relation zur Aufwandsersparnis durch den Gebrauch<br />
dieses Guts gesetzt werden. Einerseits ist kein Gr<strong>und</strong> erkennbar, warum die geistige<br />
Tätigkeit, die solche Ersparnis herbeiführt, nicht als produktiver Beitrag zur gesellschaftlichen<br />
Gesamtarbeit eingeschätzt werden soll, andererseits ist es offensichtlich unmöglich,<br />
den Wert etwa einer Erfindung in eine sinnvolle Relation zur da<strong>für</strong> verausgabten Nervenenergie<br />
zu setzen. Die Basis der Arbeitswerttheorie, in der Form, die die Wertgröße der<br />
Ware von der „hineinkristallisierten“ Arbeit abhängig macht, wird daher brüchiger, je mehr<br />
die Wissenschaft zur unmittelbaren Produktivkraft wird, ein Problem, das Marx selbst an<br />
einer Stelle in den „Gr<strong>und</strong>rissen“ ins Auge faßt, ohne allerdings weitergehende Konsequenzen<br />
<strong>für</strong> seine Wert- <strong>und</strong> Mehrwerttheorie daraus zu ziehen. 5<br />
Steiner spricht an anderer Stelle als der eingangs referierten davon, der Wert entstehe<br />
nicht „bei dem Hineinkristallisieren der Arbeit in die Ware, nicht bei dem Ersparen der<br />
Arbeit durch die Ware“, er sei vielmehr „ein Spannungszustand [...] wenn Sie hier einen<br />
elektrischen Konduktor haben [...], der sich hier entladen kann, <strong>und</strong> hier die Elektrizität<br />
aufgefangen wird, so entsteht zwischen den zweien ein Spannungszustand. Er strebt mit<br />
einer gewissen Stärke hinüber, um sich zu entladen. Wenn die Spannung nicht groß genug<br />
ist, findet keine Entladung statt [...] Auf der einen Seite steht das Gut, die Ware, in<br />
ihren Qualitäten <strong>und</strong> außerdem mit Bezug auf den Ort, an dem sie konsumiert werden<br />
kann; [...] Auf der anderen Seite steht das menschliche Bedürfnis“ (das mehr physischer<br />
oder mehr geistiger Art sein kann). 6 Diese Sätze können aber offenbar nicht meinen, daß<br />
Arbeit bzw. ihre Ersparnis überhaupt keinen Einfluß auf die Wertbildung haben, sondern<br />
nur, daß dieser Einfluß ein indirekter ist: Über die Arbeitsproduktivität <strong>und</strong> die von ihr<br />
1<br />
Wie z. B. <strong>für</strong> Popper 1973, S. 209. Für Steiner verhalten sich die Preise zu den ökonomischen Realitäten<br />
wie der Thermometerstand zur Temperatur. Vgl. GA 340, S. 30f.<br />
2<br />
Vgl. GA 340, S. 21ff.<br />
3<br />
Wilken 1976, S. 35 f.<br />
4<br />
MEW 23, S. 61.<br />
5<br />
Gr<strong>und</strong>risse, S. 592 f.<br />
6<br />
GA 188, S. 200f.