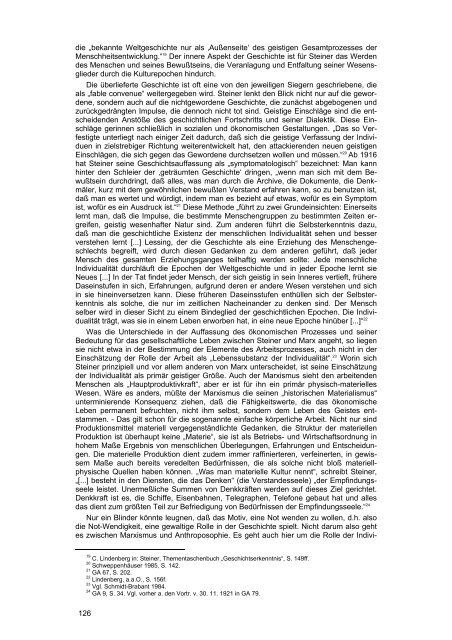Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die „bekannte Weltgeschichte nur als ‚Außenseite‘ des geistigen Gesamtprozesses der<br />
Menschheitsentwicklung.“ 19 Der innere Aspekt der Geschichte ist <strong>für</strong> Steiner das Werden<br />
des Menschen <strong>und</strong> seines Bewußtseins, die Veranlagung <strong>und</strong> Entfaltung seiner Wesensglieder<br />
durch die Kulturepochen hindurch.<br />
Die überlieferte Geschichte ist oft eine von den jeweiligen Siegern geschriebene, die<br />
als „fable convenue“ weitergegeben wird. Steiner lenkt den Blick nicht nur auf die gewordene,<br />
sondern auch auf die nichtgewordene Geschichte, die zunächst abgebogenen <strong>und</strong><br />
zurückgedrängten Impulse, die dennoch nicht tot sind. Geistige Einschläge sind die entscheidenden<br />
Anstöße des geschichtlichen Fortschritts <strong>und</strong> seiner Dialektik. Diese Einschläge<br />
gerinnen schließlich in <strong>soziale</strong>n <strong>und</strong> ökonomischen Gestaltungen. „Das so Verfestigte<br />
unterliegt nach einiger Zeit dadurch, daß sich die geistige Verfassung der Individuen<br />
in zielstrebiger Richtung weiterentwickelt hat, den attackierenden neuen geistigen<br />
Einschlägen, die sich gegen das Gewordene durchsetzen wollen <strong>und</strong> müssen.“ 20 Ab 1916<br />
hat Steiner seine Geschichtsauffassung als „symptomatologisch“ bezeichnet: Man kann<br />
hinter den Schleier der ,geträumten Geschichte‘ dringen, „wenn man sich mit dem Bewußtsein<br />
durchdringt, daß alles, was man durch die Archive, die Dokumente, die Denkmäler,<br />
kurz mit dem gewöhnlichen bewußten Verstand erfahren kann, so zu benutzen ist,<br />
daß man es wertet <strong>und</strong> würdigt, indem man es bezieht auf etwas, wo<strong>für</strong> es ein Symptom<br />
ist, wo<strong>für</strong> es ein Ausdruck ist.“ 21 Diese Methode „führt zu zwei Gr<strong>und</strong>einsichten: Einerseits<br />
lernt man, daß die Impulse, die bestimmte Menschengruppen zu bestimmten Zeiten ergreifen,<br />
geistig wesenhafter Natur sind. Zum anderen führt die Selbsterkenntnis dazu,<br />
daß man die geschichtliche Existenz der menschlichen Individualität sehen <strong>und</strong> besser<br />
verstehen lernt [...] Lessing, der die Geschichte als eine Erziehung des Menschengeschlechts<br />
begreift, wird durch diesen Gedanken zu dem anderen geführt, daß jeder<br />
Mensch des gesamten Erziehungsganges teilhaftig werden sollte: Jede menschliche<br />
Individualität durchläuft die Epochen der Weltgeschichte <strong>und</strong> in jeder Epoche lernt sie<br />
Neues [...] In der Tat findet jeder Mensch, der sich geistig in sein Inneres vertieft, frühere<br />
Daseinstufen in sich, Erfahrungen, aufgr<strong>und</strong> deren er andere Wesen verstehen <strong>und</strong> sich<br />
in sie hineinversetzen kann. Diese früheren Daseinsstufen enthüllen sich der Selbsterkenntnis<br />
als solche, die nur im zeitlichen Nacheinander zu denken sind. Der Mensch<br />
selber wird in dieser Sicht zu einem Bindeglied der geschichtlichen Epochen. Die Individualität<br />
trägt, was sie in einem Leben erworben hat, in eine neue Epoche hinüber [...]“ 22<br />
Was die Unterschiede in der Auffassung des ökonomischen Prozesses <strong>und</strong> seiner<br />
Bedeutung <strong>für</strong> das gesellschaftliche Leben zwischen Steiner <strong>und</strong> Marx angeht, so liegen<br />
sie nicht etwa in der Bestimmung der Elemente des Arbeitsprozesses, auch nicht in der<br />
Einschätzung der Rolle der Arbeit als „Lebenssubstanz der Individualität“. 23 Worin sich<br />
Steiner prinzipiell <strong>und</strong> vor allem anderen von Marx unterscheidet, ist seine Einschätzung<br />
der Individualität als primär geistiger Größe. Auch der <strong>Marxismus</strong> sieht den arbeitenden<br />
Menschen als „Hauptproduktivkraft“, aber er ist <strong>für</strong> ihn ein primär physisch-materielles<br />
Wesen. Wäre es anders, müßte der <strong>Marxismus</strong> die seinen „historischen Materialismus“<br />
unterminierende Konsequenz ziehen, daß die Fähigkeitswerte, die das ökonomische<br />
Leben permanent befruchten, nicht ihm selbst, sondern dem Leben des Geistes entstammen.<br />
- Das gilt schon <strong>für</strong> die sogenannte einfache körperliche Arbeit. Nicht nur sind<br />
Produktionsmittel materiell vergegenständlichte Gedanken, die Struktur der materiellen<br />
Produktion ist überhaupt keine „Materie“, sie ist als Betriebs- <strong>und</strong> Wirtschaftsordnung in<br />
hohem Maße Ergebnis von menschlichen Überlegungen, Erfahrungen <strong>und</strong> Entscheidungen.<br />
Die materielle Produktion dient zudem immer raffinierteren, verfeinerten, in gewissem<br />
Maße auch bereits veredelten Bedürfnissen, die als solche nicht bloß materiellphysische<br />
Quellen haben können. „Was man materielle Kultur nennt“, schreibt Steiner,<br />
„[...] besteht in den Diensten, die das Denken“ (die Verstandesseele) „der Empfindungsseele<br />
leistet. Unermeßliche Summen von Denkkräften werden auf dieses Ziel gerichtet.<br />
Denkkraft ist es, die Schiffe, Eisenbahnen, Telegraphen, Telefone gebaut hat <strong>und</strong> alles<br />
das dient zum größten Teil zur Befriedigung von Bedürfnissen der Empfindungsseele.“ 24<br />
Nur ein Blinder könnte leugnen, daß das Motiv, eine Not wenden zu wollen, d.h. also<br />
die Not-Wendigkeit, eine gewaltige Rolle in der Geschichte spielt. Nicht darum also geht<br />
es zwischen <strong>Marxismus</strong> <strong>und</strong> <strong>Anthroposophie</strong>. Es geht auch hier um die Rolle der Indivi-<br />
19<br />
C. Lindenberg in: Steiner, Thementaschenbuch „Geschichtserkenntnis“, S. 149ff.<br />
20<br />
Schweppenhäuser 1985, S. 142.<br />
21<br />
GA 67, S. 202.<br />
22<br />
Lindenberg, a.a.O., S. 156f.<br />
23<br />
Vgl. Schmidt-Brabant 1984.<br />
24<br />
GA 9, S. 34. Vgl. vorher a. den Vortr. v. 30. 11. 1921 in GA 79.<br />
126