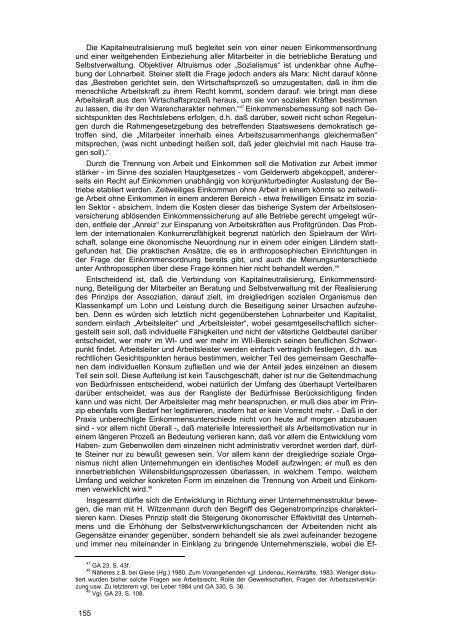Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Kapitalneutralisierung muß begleitet sein von einer neuen Einkommensordnung<br />
<strong>und</strong> einer weitgehenden Einbeziehung aller Mitarbeiter in die betriebliche Beratung <strong>und</strong><br />
Selbstverwaltung. Objektiver Altruismus oder „Sozialismus“ ist <strong>und</strong>enkbar ohne Aufhebung<br />
der Lohnarbeit. Steiner stellt die Frage jedoch anders als Marx: Nicht darauf könne<br />
das „Bestreben gerichtet sein, den Wirtschaftsprozeß so umzugestalten, daß in ihm die<br />
menschliche Arbeitskraft zu ihrem Recht kommt, sondern darauf: wie bringt man diese<br />
Arbeitskraft aus dem Wirtschaftsprozeß heraus, um sie von <strong>soziale</strong>n Kräften bestimmen<br />
zu lassen, die ihr den Warencharakter nehmen.“ 47 Einkommensbemessung soll nach Gesichtspunkten<br />
des Rechtslebens erfolgen, d.h. daß darüber, soweit nicht schon Regelungen<br />
durch die Rahmengesetzgebung des betreffenden Staatswesens demokratisch getroffen<br />
sind, die „Mitarbeiter innerhalb eines Arbeitszusammenhangs gleichermaßen“<br />
mitsprechen, (was nicht unbedingt heißen soll, daß jeder gleichviel mit nach Hause tragen<br />
soll).“<br />
Durch die Trennung von Arbeit <strong>und</strong> Einkommen soll die Motivation zur Arbeit immer<br />
stärker - im Sinne des <strong>soziale</strong>n Hauptgesetzes - vom Gelderwerb abgekoppelt, andererseits<br />
ein Recht auf Einkommen unabhängig von konjunkturbedingter Auslastung der Betriebe<br />
etabliert werden. Zeitweiliges Einkommen ohne Arbeit in einem könnte so zeitweilige<br />
Arbeit ohne Einkommen in einem anderen Bereich - etwa freiwilligen Einsatz im <strong>soziale</strong>n<br />
Sektor - absichern. Indem die Kosten dieser das bisherige System der Arbeitslosenversicherung<br />
ablösenden Einkommenssicherung auf alle Betriebe gerecht umgelegt würden,<br />
entfiele der „Anreiz“ zur Einsparung von Arbeitskräften aus Profitgründen. Das Problem<br />
der internationalen Konkurrenzfähigkeit begrenzt natürlich den Spielraum der Wirtschaft,<br />
solange eine ökonomische Neuordnung nur in einem oder einigen Ländern stattgef<strong>und</strong>en<br />
hat. Die praktischen Ansätze, die es in anthroposophischen Einrichtungen in<br />
der Frage der Einkommensordnung bereits gibt, <strong>und</strong> auch die Meinungsunterschiede<br />
unter Anthroposophen über diese Frage können hier nicht behandelt werden. 48<br />
Entscheidend ist, daß die Verbindung von Kapitalneutralisierung, Einkommensordnung,<br />
Beteiligung der Mitarbeiter an Beratung <strong>und</strong> Selbstverwaltung mit der Realisierung<br />
des Prinzips der Assoziation, darauf zielt, im dreigliedrigen <strong>soziale</strong>n Organismus den<br />
Klassenkampf um Lohn <strong>und</strong> Leistung durch die Beseitigung seiner Ursachen aufzuheben.<br />
Denn es würden sich letztlich nicht gegenüberstehen Lohnarbeiter <strong>und</strong> Kapitalist,<br />
sondern einfach „Arbeitsleiter“ <strong>und</strong> „Arbeitsleister“, wobei gesamtgesellschaftlich sichergestellt<br />
sein soll, daß individuelle Fähigkeiten <strong>und</strong> nicht der väterliche Geldbeutel darüber<br />
entscheidet, wer mehr im WI- <strong>und</strong> wer mehr im WII-Bereich seinen beruflichen Schwerpunkt<br />
findet. Arbeitsleiter <strong>und</strong> Arbeitsleister werden einfach vertraglich festlegen, d.h. aus<br />
rechtlichen Gesichtspunkten heraus bestimmen, welcher Teil des gemeinsam Geschaffenen<br />
dem individuellen Konsum zufließen <strong>und</strong> wie der Anteil jedes einzelnen an diesem<br />
Teil sein soll. Diese Aufteilung ist kein Tauschgeschäft, daher ist nur die Geltendmachung<br />
von Bedürfnissen entscheidend, wobei natürlich der Umfang des überhaupt Verteilbaren<br />
darüber entscheidet, was aus der Rangliste der Bedürfnisse Berücksichtigung finden<br />
kann <strong>und</strong> was nicht. Der Arbeitsleiter mag mehr beanspruchen, er muß dies aber im Prinzip<br />
ebenfalls vom Bedarf her legitimieren, insofern hat er kein Vorrecht mehr. - Daß in der<br />
Praxis unberechtigte Einkommensunterschiede nicht von heute auf morgen abzubauen<br />
sind - vor allem nicht überall -, daß materielle Interessiertheit als Arbeitsmotivation nur in<br />
einem längeren Prozeß an Bedeutung verlieren kann, daß vor allem die Entwicklung vom<br />
Haben- zum Gebenwollen dem einzelnen nicht administrativ verordnet werden darf, dürfte<br />
Steiner nur zu bewußt gewesen sein. Vor allem kann der dreigliedrige <strong>soziale</strong> Organismus<br />
nicht allen Unternehmungen ein identisches Modell aufzwingen; er muß es den<br />
innerbetrieblichen Willensbildungsprozessen überlassen, in welchem Tempo, welchem<br />
Umfang <strong>und</strong> welcher konkreten Form im einzelnen die Trennung von Arbeit <strong>und</strong> Einkommen<br />
verwirklicht wird. 49<br />
Insgesamt dürfte sich die Entwicklung in Richtung einer Unternehmensstruktur bewegen,<br />
die man mit H. Witzenmann durch den Begriff des Gegenstromprinzips charakterisieren<br />
kann. Dieses Prinzip stellt die Steigerung ökonomischer Effektivität des Unternehmens<br />
<strong>und</strong> die Erhöhung der Selbstverwirklichungschancen der Arbeitenden nicht als<br />
Gegensätze einander gegenüber, sondern behandelt sie als zwei aufeinander bezogene<br />
<strong>und</strong> immer neu miteinander in Einklang zu bringende Unternehmensziele, wobei die Ef-<br />
47 GA 23, S. 43f.<br />
48 Näheres z.B. bei Giese (Hg.) 1980. Zum Vorangehenden vgl. Lindenau, Keimkräfte, 1983. Weniger diskutiert<br />
wurden bisher solche Fragen wie Arbeitsrecht, Rolle der Gewerkschaften, Fragen der Arbeitszeitverkürzung<br />
usw. Zu letzterem vgl. bei Leber 1984 <strong>und</strong> GA 330, S. 36.<br />
49 Vgl. GA 23, S. 108.<br />
155