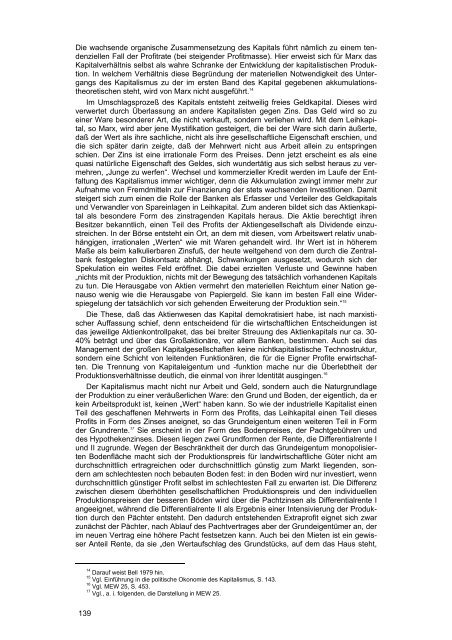Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals führt nämlich zu einem tendenziellen<br />
Fall der Profitrate (bei steigender Profitmasse). Hier erweist sich <strong>für</strong> Marx das<br />
Kapitalverhältnis selbst als wahre Schranke der Entwicklung der kapitalistischen Produktion.<br />
In welchem Verhältnis diese Begründung der materiellen Notwendigkeit des Untergangs<br />
des Kapitalismus zu der im ersten Band des Kapital gegebenen akkumulationstheoretischen<br />
steht, wird von Marx nicht ausgeführt. 14<br />
Im Umschlagsprozeß des Kapitals entsteht zeitweilig freies Geldkapital. Dieses wird<br />
verwertet durch Überlassung an andere Kapitalisten gegen Zins. Das Geld wird so zu<br />
einer Ware besonderer Art, die nicht verkauft, sondern verliehen wird. Mit dem Leihkapital,<br />
so Marx, wird aber jene Mystifikation gesteigert, die bei der Ware sich darin äußerte,<br />
daß der Wert als ihre sachliche, nicht als ihre gesellschaftliche Eigenschaft erschien, <strong>und</strong><br />
die sich später darin zeigte, daß der Mehrwert nicht aus Arbeit allein zu entspringen<br />
schien. Der Zins ist eine irrationale Form des Preises. Denn jetzt erscheint es als eine<br />
quasi natürliche Eigenschaft des Geldes, sich w<strong>und</strong>ertätig aus sich selbst heraus zu vermehren,<br />
„Junge zu werfen“. Wechsel <strong>und</strong> kommerzieller Kredit werden im Laufe der Entfaltung<br />
des Kapitalismus immer wichtiger, denn die Akkumulation zwingt immer mehr zur<br />
Aufnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung der stets wachsenden Investitionen. Damit<br />
steigert sich zum einen die Rolle der Banken als Erfasser <strong>und</strong> Verteiler des Geldkapitals<br />
<strong>und</strong> Verwandler von Spareinlagen in Leihkapital. Zum anderen bildet sich das Aktienkapital<br />
als besondere Form des zinstragenden Kapitals heraus. Die Aktie berechtigt ihren<br />
Besitzer bekanntlich, einen Teil des Profits der Aktiengesellschaft als Dividende einzustreichen.<br />
In der Börse entsteht ein Ort, an dem mit diesen, vom Arbeitswert relativ unabhängigen,<br />
irrationalen „Werten“ wie mit Waren gehandelt wird. Ihr Wert ist in höherem<br />
Maße als beim kalkulierbaren Zinsfuß, der heute weitgehend von dem durch die Zentralbank<br />
festgelegten Diskontsatz abhängt, Schwankungen ausgesetzt, wodurch sich der<br />
Spekulation ein weites Feld eröffnet. Die dabei erzielten Verluste <strong>und</strong> Gewinne haben<br />
„nichts mit der Produktion, nichts mit der Bewegung des tatsächlich vorhandenen Kapitals<br />
zu tun. Die Herausgabe von Aktien vermehrt den materiellen Reichtum einer Nation genauso<br />
wenig wie die Herausgabe von Papiergeld. Sie kann im besten Fall eine Widerspiegelung<br />
der tatsächlich vor sich gehenden Erweiterung der Produktion sein.“ 15<br />
Die These, daß das Aktienwesen das Kapital demokratisiert habe, ist nach marxistischer<br />
Auffassung schief, denn entscheidend <strong>für</strong> die wirtschaftlichen Entscheidungen ist<br />
das jeweilige Aktienkontrollpaket, das bei breiter Streuung des Aktienkapitals nur ca. 30-<br />
40% beträgt <strong>und</strong> über das Großaktionäre, vor allem Banken, bestimmen. Auch sei das<br />
Management der großen Kapitalgesellschaften keine nichtkapitalistische Technostruktur,<br />
sondern eine Schicht von leitenden Funktionären, die <strong>für</strong> die Eigner Profite erwirtschaften.<br />
Die Trennung von Kapitaleigentum <strong>und</strong> -funktion mache nur die Überlebtheit der<br />
Produktionsverhältnisse deutlich, die einmal von ihrer Identität ausgingen. 16<br />
Der Kapitalismus macht nicht nur Arbeit <strong>und</strong> Geld, sondern auch die Naturgr<strong>und</strong>lage<br />
der Produktion zu einer veräußerlichen Ware: den Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden, der eigentlich, da er<br />
kein Arbeitsprodukt ist, keinen „Wert“ haben kann. So wie der industrielle Kapitalist einen<br />
Teil des geschaffenen Mehrwerts in Form des Profits, das Leihkapital einen Teil dieses<br />
Profits in Form des Zinses aneignet, so das Gr<strong>und</strong>eigentum einen weiteren Teil in Form<br />
der Gr<strong>und</strong>rente. 17 Sie erscheint in der Form des Bodenpreises, der Pachtgebühren <strong>und</strong><br />
des Hypothekenzinses. Diesen liegen zwei Gr<strong>und</strong>formen der Rente, die Differentialrente I<br />
<strong>und</strong> II zugr<strong>und</strong>e. Wegen der Beschränktheit der durch das Gr<strong>und</strong>eigentum monopolisierten<br />
Bodenfläche macht sich der Produktionspreis <strong>für</strong> landwirtschaftliche Güter nicht am<br />
durchschnittlich ertragreichen oder durchschnittlich günstig zum Markt liegenden, sondern<br />
am schlechtesten noch bebauten Boden fest: in den Boden wird nur investiert, wenn<br />
durchschnittlich günstiger Profit selbst im schlechtesten Fall zu erwarten ist. Die Differenz<br />
zwischen diesem überhöhten gesellschaftlichen Produktionspreis <strong>und</strong> den individuellen<br />
Produktionspreisen der besseren Böden wird über die Pachtzinsen als Differentialrente I<br />
angeeignet, während die Differentialrente II als Ergebnis einer Intensivierung der Produktion<br />
durch den Pächter entsteht. Den dadurch entstehenden Extraprofit eignet sich zwar<br />
zunächst der Pächter, nach Ablauf des Pachtvertrages aber der Gr<strong>und</strong>eigentümer an, der<br />
im neuen Vertrag eine höhere Pacht festsetzen kann. Auch bei den Mieten ist ein gewisser<br />
Anteil Rente, da sie „den Wertaufschlag des Gr<strong>und</strong>stücks, auf dem das Haus steht,<br />
14<br />
Darauf weist Bell 1979 hin.<br />
15<br />
Vgl. Einführung in die politische Okonomie des Kapitalismus, S. 143.<br />
16<br />
Vgl. MEW 25, S. 453.<br />
17<br />
Vgl., a. i. folgenden, die Darstellung in MEW 25.<br />
139