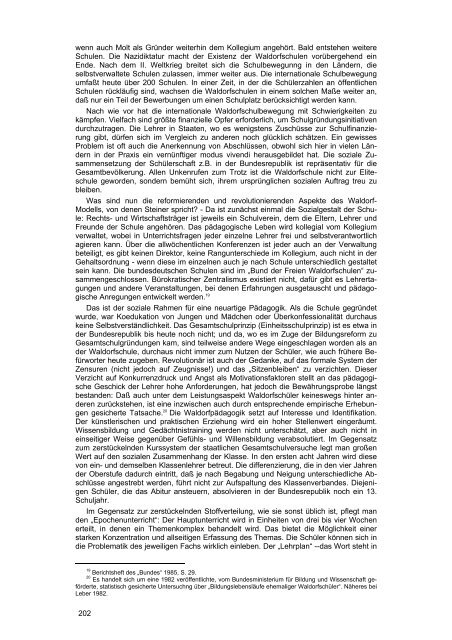Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wenn auch Molt als Gründer weiterhin dem Kollegium angehört. Bald entstehen weitere<br />
Schulen. Die Nazidiktatur macht der Existenz der Waldorfschulen vorübergehend ein<br />
Ende. Nach dem II. Weltkrieg breitet sich die Schulbewegunng in den Ländern, die<br />
selbstverwaltete Schulen zulassen, immer weiter aus. Die internationale Schulbewegung<br />
umfaßt heute über 200 Schulen. In einer Zeit, in der die Schülerzahlen an öffentlichen<br />
Schulen rückläufig sind, wachsen die Waldorfschulen in einem solchen Maße weiter an,<br />
daß nur ein Teil der Bewerbungen um einen Schulplatz berücksichtigt werden kann.<br />
Nach wie vor hat die internationale Waldorfschulbewegung mit Schwierigkeiten zu<br />
kämpfen. Vielfach sind größte finanzielle Opfer erforderlich, um Schulgründungsinitiativen<br />
durchzutragen. Die Lehrer in Staaten, wo es wenigstens Zuschüsse zur Schulfinanzierung<br />
gibt, dürfen sich im Vergleich zu anderen noch glücklich schätzen. Ein gewisses<br />
Problem ist oft auch die Anerkennung von Abschlüssen, obwohl sich hier in vielen Ländern<br />
in der Praxis ein vernünftiger modus vivendi herausgebildet hat. Die <strong>soziale</strong> Zusammensetzung<br />
der Schülerschaft z.B. in der B<strong>und</strong>esrepublik ist repräsentativ <strong>für</strong> die<br />
Gesamtbevölkerung. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Waldorfschule nicht zur Eliteschule<br />
geworden, sondern bemüht sich, ihrem ursprünglichen <strong>soziale</strong>n Auftrag treu zu<br />
bleiben.<br />
Was sind nun die reformierenden <strong>und</strong> revolutionierenden Aspekte des Waldorf-<br />
Modells, von denen Steiner spricht? - Da ist zunächst einmal die Sozialgestalt der Schule:<br />
Rechts- <strong>und</strong> Wirtschaftsträger ist jeweils ein Schulverein, dem die Eltern, Lehrer <strong>und</strong><br />
Fre<strong>und</strong>e der Schule angehören. Das pädagogische Leben wird kollegial vom Kollegium<br />
verwaltet, wobei in Unterrichtsfragen jeder einzelne Lehrer frei <strong>und</strong> selbstverantwortlich<br />
agieren kann. Über die allwöchentlichen Konferenzen ist jeder auch an der Verwaltung<br />
beteiligt, es gibt keinen Direktor, keine Rangunterschiede im Kollegium, auch nicht in der<br />
Gehaltsordnung - wenn diese im einzelnen auch je nach Schule unterschiedlich gestaltet<br />
sein kann. Die b<strong>und</strong>esdeutschen Schulen sind im „B<strong>und</strong> der Freien Waldorfschulen“ zusammengeschlossen.<br />
Bürokratischer Zentralismus existiert nicht, da<strong>für</strong> gibt es Lehrertagungen<br />
<strong>und</strong> andere Veranstaltungen, bei denen Erfahrungen ausgetauscht <strong>und</strong> pädagogische<br />
Anregungen entwickelt werden. 19<br />
Das ist der <strong>soziale</strong> Rahmen <strong>für</strong> eine neuartige Pädagogik. Als die Schule gegründet<br />
wurde, war Koedukation von Jungen <strong>und</strong> Mädchen oder Überkonfessionalität durchaus<br />
keine Selbstverständlichkeit. Das Gesamtschulprinzip (Einheitsschulprinzip) ist es etwa in<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik bis heute noch nicht; <strong>und</strong> da, wo es im Zuge der Bildungsreform zu<br />
Gesamtschulgründungen kam, sind teilweise andere Wege eingeschlagen worden als an<br />
der Waldorfschule, durchaus nicht immer zum Nutzen der Schüler, wie auch frühere Be<strong>für</strong>worter<br />
heute zugeben. Revolutionär ist auch der Gedanke, auf das formale System der<br />
Zensuren (nicht jedoch auf Zeugnisse!) <strong>und</strong> das „Sitzenbleiben“ zu verzichten. Dieser<br />
Verzicht auf Konkurrenzdruck <strong>und</strong> Angst als Motivationsfaktoren stellt an das pädagogische<br />
Geschick der Lehrer hohe Anforderungen, hat jedoch die Bewährungsprobe längst<br />
bestanden: Daß auch unter dem Leistungsaspekt Waldorfschüler keineswegs hinter anderen<br />
zurückstehen, ist eine inzwischen auch durch entsprechende empirische Erhebungen<br />
gesicherte Tatsache. 20 Die Waldorfpädagogik setzt auf Interesse <strong>und</strong> Identifikation.<br />
Der künstlerischen <strong>und</strong> praktischen Erziehung wird ein hoher Stellenwert eingeräumt.<br />
Wissensbildung <strong>und</strong> Gedächtnistraining werden nicht unterschätzt, aber auch nicht in<br />
einseitiger Weise gegenüber Gefühls- <strong>und</strong> Willensbildung verabsolutiert. Im Gegensatz<br />
zum zerstückelnden Kurssystem der staatlichen Gesamtschulversuche legt man großen<br />
Wert auf den <strong>soziale</strong>n Zusammenhang der Klasse. In den ersten acht Jahren wird diese<br />
von ein- <strong>und</strong> demselben Klassenlehrer betreut. Die differenzierung, die in den vier Jahren<br />
der Oberstufe dadurch eintritt, daß je nach Begabung <strong>und</strong> Neigung unterschiedliche Abschlüsse<br />
angestrebt werden, führt nicht zur Aufspaltung des Klassenverbandes. Diejenigen<br />
Schüler, die das Abitur ansteuern, absolvieren in der B<strong>und</strong>esrepublik noch ein 13.<br />
Schuljahr.<br />
Im Gegensatz zur zerstückelnden Stoffverteilung, wie sie sonst üblich ist, pflegt man<br />
den „Epochenunterricht“: Der Hauptunterricht wird in Einheiten von drei bis vier Wochen<br />
erteilt, in denen ein Themenkomplex behandelt wird. Das bietet die Möglichkeit einer<br />
starken Konzentration <strong>und</strong> allseitigen Erfassung des Themas. Die Schüler können sich in<br />
die Problematik des jeweiligen Fachs wirklich einleben. Der „Lehrplan“ --das Wort steht in<br />
19 Berichtsheft des „B<strong>und</strong>es“ 1985, S. 29.<br />
20 Es handelt sich um eine 1982 veröffentlichte, vom B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft geförderte,<br />
statistisch gesicherte Untersuchng über „Bildungslebensläufe ehemaliger Waldorfschüler“. Näheres bei<br />
Leber 1982.<br />
202