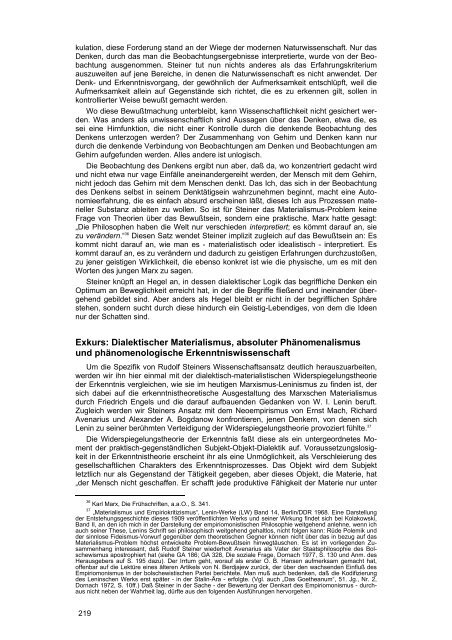Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
kulation, diese Forderung stand an der Wiege der modernen Naturwissenschaft. Nur das<br />
Denken, durch das man die Beobachtungsergebnisse interpretierte, wurde von der Beobachtung<br />
ausgenommen. Steiner tut nun nichts anderes als das Erfahrungskriterium<br />
auszuweiten auf jene Bereiche, in denen die Naturwissenschaft es nicht anwendet. Der<br />
Denk- <strong>und</strong> Erkenntnisvorgang, der gewöhnlich der Aufmerksamkeit entschlüpft, weil die<br />
Aufmerksamkeit allein auf Gegenstände sich richtet, die es zu erkennen gilt, sollen in<br />
kontrollierter Weise bewußt gemacht werden.<br />
Wo diese Bewußtmachung unterbleibt, kann Wissenschaftlichkeit nicht gesichert werden.<br />
Was anders als unwissenschaftlich sind Aussagen über das Denken, etwa die, es<br />
sei eine Hirnfunktion, die nicht einer Kontrolle durch die denkende Beobachtung des<br />
Denkens unterzogen werden? Der Zusammenhang von Gehirn <strong>und</strong> Denken kann nur<br />
durch die denkende Verbindung von Beobachtungen am Denken <strong>und</strong> Beobachtungen am<br />
Gehirn aufgef<strong>und</strong>en werden. Alles andere ist unlogisch.<br />
Die Beobachtung des Denkens ergibt nun aber, daß da, wo konzentriert gedacht wird<br />
<strong>und</strong> nicht etwa nur vage Einfälle aneinandergereiht werden, der Mensch mit dem Gehirn,<br />
nicht jedoch das Gehirn mit dem Menschen denkt. Das Ich, das sich in der Beobachtung<br />
des Denkens selbst in seinem Denktätigsein wahrzunehmen beginnt, macht eine Autonomieerfahrung,<br />
die es einfach absurd erscheinen läßt, dieses Ich aus Prozessen materieller<br />
Substanz ableiten zu wollen. So ist <strong>für</strong> Steiner das Materialismus-Problem keine<br />
Frage von Theorien über das Bewußtsein, sondern eine praktische. Marx hatte gesagt:<br />
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt darauf an, sie<br />
zu verändern.“ 36 Diesen Satz wendet Steiner implizit zugleich auf das Bewußtsein an: Es<br />
kommt nicht darauf an, wie man es - materialistisch oder idealistisch - interpretiert. Es<br />
kommt darauf an, es zu verändern <strong>und</strong> dadurch zu geistigen Erfahrungen durchzustoßen,<br />
zu jener geistigen Wirklichkeit, die ebenso konkret ist wie die physische, um es mit den<br />
Worten des jungen Marx zu sagen.<br />
Steiner knüpft an Hegel an, in dessen dialektischer Logik das begriffliche Denken ein<br />
Optimum an Beweglichkeit erreicht hat, in der die Begriffe fließend <strong>und</strong> ineinander übergehend<br />
gebildet sind. Aber anders als Hegel bleibt er nicht in der begrifflichen Sphäre<br />
stehen, sondern sucht durch diese hindurch ein Geistig-Lebendiges, von dem die Ideen<br />
nur der Schatten sind.<br />
Exkurs: Dialektischer Materialismus, absoluter Phänomenalismus<br />
<strong>und</strong> phänomenologische Erkenntniswissenschaft<br />
Um die Spezifik von Rudolf Steiners Wissenschaftsansatz deutlich herauszuarbeiten,<br />
werden wir ihn hier einmal mit der dialektisch-materialistischen Widerspiegelungstheorie<br />
der Erkenntnis vergleichen, wie sie im heutigen <strong>Marxismus</strong>-Leninismus zu finden ist, der<br />
sich dabei auf die erkenntnistheoretische Ausgestaltung des Marxschen Materialismus<br />
durch Friedrich Engels <strong>und</strong> die darauf aufbauenden Gedanken von W. I. Lenin beruft.<br />
Zugleich werden wir Steiners Ansatz mit dem Neoempirismus von Ernst Mach, Richard<br />
Avenarius <strong>und</strong> Alexander A. Bogdanow konfrontieren, jenen Denkern, von denen sich<br />
Lenin zu seiner berühmten Verteidigung der Widerspiegelungstheorie provoziert fühlte. 37<br />
Die Widerspiegelungstheorie der Erkenntnis faßt diese als ein untergeordnetes Moment<br />
der praktisch-gegenständlichen Subjekt-Objekt-Dialektik auf. Voraussetzungslosigkeit<br />
in der Erkenntnistheorie erscheint ihr als eine Unmöglichkeit, als Verschleierung des<br />
gesellschaftlichen Charakters des Erkenntnisprozesses. Das Objekt wird dem Subjekt<br />
letztlich nur als Gegenstand der Tätigkeit gegeben, aber dieses Objekt, die Materie, hat<br />
„der Mensch nicht geschaffen. Er schafft jede produktive Fähigkeit der Materie nur unter<br />
36 Karl Marx, Die Frühschriften, a.a.O., S. 341.<br />
37 „Materialismus <strong>und</strong> Empiriokritizismus“, Lenin-Werke (LW) Band 14, Berlin/DDR 1968. Eine Darstellung<br />
der Entstehungsgeschichte dieses 1909 veröffentlichten Werks <strong>und</strong> seiner Wirkung findet sich bei Kolakowski,<br />
Band II, an den ich mich in der Darstellung der empiriomonistischen Philosophie weitgehend anlehne, wenn ich<br />
auch seiner These, Lenins Schrift sei philosophisch weitgehend gehaltlos, nicht folgen kann: Rüde Polemik <strong>und</strong><br />
der sinnlose Fideismus-Vorwurf gegenüber dem theoretischen Gegner können nicht über das in bezug auf das<br />
Materialismus-Problem höchst entwickelte Problem-Bewußtsein hinwegtäuschen. Es ist im vorliegenden Zusammenhang<br />
interessant, daß Rudolf Steiner wiederholt Avenarius als Vater der Staatsphilosophie des Bolschewismus<br />
apostrophiert hat (siehe GA 186; GA 328, Die <strong>soziale</strong> Frage, Dornach 1977, S. 130 <strong>und</strong> Anm. des<br />
Herausgebers auf S. 195 dazu). Der Irrtum geht, worauf als erster O. B. Hansen aufmerksam gemacht hat,<br />
offenbar auf die Lektüre eines älteren Artikels von N. Berdjajew zurück, der über den wachsenden Einfluß des<br />
Empiriomonismus in der bolschewistischen Partei berichtete. Man muß auch bedenken, daß die Kodifizierung<br />
des Leninschen Werks erst später - in der Stalin-Ära - erfolgte. (Vgl. auch „Das Goetheanum“, 51. Jg., Nr. 2,<br />
Dornach 1972, S. 10ff.) Daß Steiner in der Sache - der Bewertung der Denkart des Empiriomonismus - durchaus<br />
nicht neben der Wahrheit lag, dürfte aus den folgenden Ausführungen hervorgehen.<br />
219