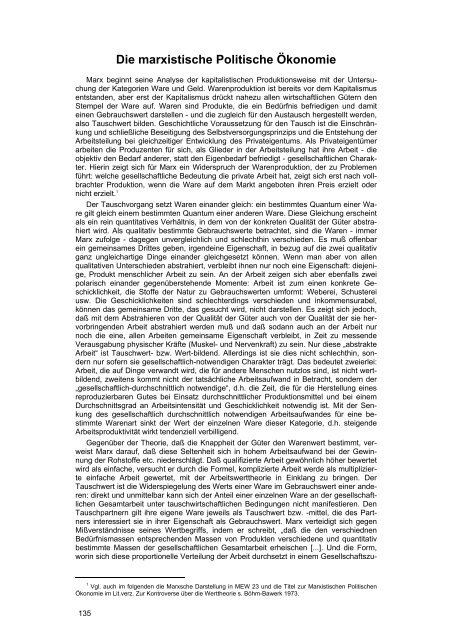Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
135<br />
Die marxistische Politische Ökonomie<br />
Marx beginnt seine Analyse der kapitalistischen Produktionsweise mit der Untersuchung<br />
der Kategorien Ware <strong>und</strong> Geld. Warenproduktion ist bereits vor dem Kapitalismus<br />
entstanden, aber erst der Kapitalismus drückt nahezu allen wirtschaftlichen Gütern den<br />
Stempel der Ware auf. Waren sind Produkte, die ein Bedürfnis befriedigen <strong>und</strong> damit<br />
einen Gebrauchswert darstellen - <strong>und</strong> die zugleich <strong>für</strong> den Austausch hergestellt werden,<br />
also Tauschwert bilden. Geschichtliche Voraussetzung <strong>für</strong> den Tausch ist die Einschränkung<br />
<strong>und</strong> schließliche Beseitigung des Selbstversorgungsprinzips <strong>und</strong> die Entstehung der<br />
Arbeitsteilung bei gleichzeitiger Entwicklung des Privateigentums. Als Privateigentümer<br />
arbeiten die Produzenten <strong>für</strong> sich, als Glieder in der Arbeitsteilung hat ihre Arbeit - die<br />
objektiv den Bedarf anderer, statt den Eigenbedarf befriedigt - gesellschaftlichen Charakter.<br />
Hierin zeigt sich <strong>für</strong> Marx ein Widerspruch der Warenproduktion, der zu Problemen<br />
führt: welche gesellschaftliche Bedeutung die private Arbeit hat, zeigt sich erst nach vollbrachter<br />
Produktion, wenn die Ware auf dem Markt angeboten ihren Preis erzielt oder<br />
nicht erzielt. 1<br />
Der Tauschvorgang setzt Waren einander gleich: ein bestimmtes Quantum einer Ware<br />
gilt gleich einem bestimmten Quantum einer anderen Ware. Diese Gleichung erscheint<br />
als ein rein quantitatives Verhältnis, in dem von der konkreten Qualität der Güter abstrahiert<br />
wird. Als qualitativ bestimmte Gebrauchswerte betrachtet, sind die Waren - immer<br />
Marx zufolge - dagegen unvergleichlich <strong>und</strong> schlechthin verschieden. Es muß offenbar<br />
ein gemeinsames Drittes geben, irgendeine Eigenschaft, in bezug auf die zwei qualitativ<br />
ganz ungleichartige Dinge einander gleichgesetzt können. Wenn man aber von allen<br />
qualitativen Unterschieden abstrahiert, verbleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft: diejenige,<br />
Produkt menschlicher Arbeit zu sein. An der Arbeit zeigen sich aber ebenfalls zwei<br />
polarisch einander gegenüberstehende Momente: Arbeit ist zum einen konkrete Geschicklichkeit,<br />
die Stoffe der Natur zu Gebrauchswerten umformt: Weberei, Schusterei<br />
usw. Die Geschicklichkeiten sind schlechterdings verschieden <strong>und</strong> inkommensurabel,<br />
können das gemeinsame Dritte, das gesucht wird, nicht darstellen. Es zeigt sich jedoch,<br />
daß mit dem Abstrahieren von der Qualität der Güter auch von der Qualität der sie hervorbringenden<br />
Arbeit abstrahiert werden muß <strong>und</strong> daß sodann auch an der Arbeit nur<br />
noch die eine, allen Arbeiten gemeinsame Eigenschaft verbleibt, in Zeit zu messende<br />
Verausgabung physischer Kräfte (Muskel- <strong>und</strong> Nervenkraft) zu sein. Nur diese „abstrakte<br />
Arbeit“ ist Tauschwert- bzw. Wert-bildend. Allerdings ist sie dies nicht schlechthin, sondern<br />
nur sofern sie gesellschaftlich-notwendigen Charakter trägt. Das bedeutet zweierlei:<br />
Arbeit, die auf Dinge verwandt wird, die <strong>für</strong> andere Menschen nutzlos sind, ist nicht wertbildend,<br />
zweitens kommt nicht der tatsächliche Arbeitsaufwand in Betracht, sondern der<br />
„gesellschaftlich-durchschnittlich notwendige“, d.h. die Zeit, die <strong>für</strong> die Herstellung eines<br />
reproduzierbaren Gutes bei Einsatz durchschnittlicher Produktionsmittel <strong>und</strong> bei einem<br />
Durchschnittsgrad an Arbeitsintensität <strong>und</strong> Geschicklichkeit notwendig ist. Mit der Senkung<br />
des gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeitsaufwandes <strong>für</strong> eine bestimmte<br />
Warenart sinkt der Wert der einzelnen Ware dieser Kategorie, d.h. steigende<br />
Arbeitsproduktivität wirkt tendenziell verbilligend.<br />
Gegenüber der Theorie, daß die Knappheit der Güter den Warenwert bestimmt, verweist<br />
Marx darauf, daß diese Seltenheit sich in hohem Arbeitsaufwand bei der Gewinnung<br />
der Rohstoffe etc. niederschlägt. Daß qualifizierte Arbeit gewöhnlich höher bewertet<br />
wird als einfache, versucht er durch die Formel, komplizierte Arbeit werde als multiplizierte<br />
einfache Arbeit gewertet, mit der Arbeitswerttheorie in Einklang zu bringen. Der<br />
Tauschwert ist die Widerspiegelung des Werts einer Ware im Gebrauchswert einer anderen:<br />
direkt <strong>und</strong> unmittelbar kann sich der Anteil einer einzelnen Ware an der gesellschaftlichen<br />
Gesamtarbeit unter tauschwirtschaftlichen Bedingungen nicht manifestieren. Den<br />
Tauschpartnern gilt ihre eigene Ware jeweils als Tauschwert bzw. -mittel, die des Partners<br />
interessiert sie in ihrer Eigenschaft als Gebrauchswert. Marx verteidigt sich gegen<br />
Mißverständnisse seines Wertbegriffs, indem er schreibt, „daß die den verschiednen<br />
Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedene <strong>und</strong> quantitativ<br />
bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen [...]. Und die Form,<br />
worin sich diese proportionelle Verteilung der Arbeit durchsetzt in einem Gesellschaftszu-<br />
1 Vgl. auch im folgenden die Marxsche Darstellung in MEW 23 <strong>und</strong> die Titel zur Marxistischen Politischen<br />
Ökonomie im Lit.verz. Zur Kontroverse über die Werttheorie s. Böhm-Bawerk 1973.