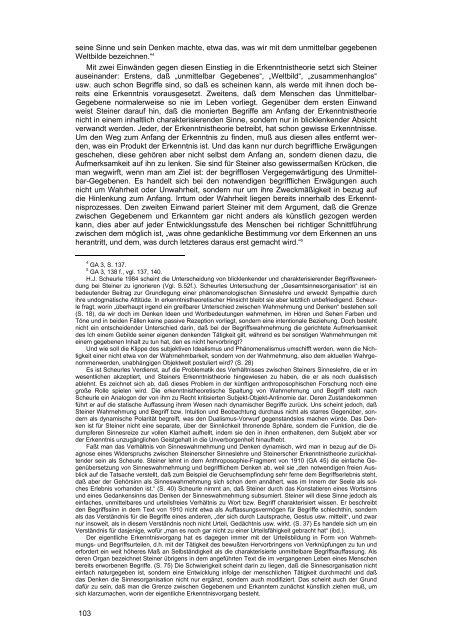Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
seine Sinne <strong>und</strong> sein Denken machte, etwa das, was wir mit dem unmittelbar gegebenen<br />
Weltbilde bezeichnen.“ 4<br />
Mit zwei Einwänden gegen diesen Einstieg in die Erkenntnistheorie setzt sich Steiner<br />
auseinander: Erstens, daß „unmittelbar Gegebenes“, „Weltbild“, „zusammenhanglos“<br />
usw. auch schon Begriffe sind, so daß es scheinen kann, als werde mit ihnen doch bereits<br />
eine Erkenntnis vorausgesetzt. Zweitens, daß dem Menschen das Unmittelbar-<br />
Gegebene normalerweise so nie im Leben vorliegt. Gegenüber dem ersten Einwand<br />
weist Steiner darauf hin, daß die monierten Begriffe am Anfang der Erkenntnistheorie<br />
nicht in einem inhaltlich charakterisierenden Sinne, sondern nur in blicklenkender Absicht<br />
verwandt werden. Jeder, der Erkenntnistheorie betreibt, hat schon gewisse Erkenntnisse.<br />
Um den Weg zum Anfang der Erkenntnis zu finden, muß aus diesen alles entfernt werden,<br />
was ein Produkt der Erkenntnis ist. Und das kann nur durch begriffliche Erwägungen<br />
geschehen, diese gehören aber nicht selbst dem Anfang an, sondern dienen dazu, die<br />
Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Sie sind <strong>für</strong> Steiner also gewissermaßen Krücken, die<br />
man wegwirft, wenn man am Ziel ist: der begrifflosen Vergegenwärtigung des Unmittelbar-Gegebenen.<br />
Es handelt sich bei den notwendigen begrifflichen Erwägungen auch<br />
nicht um Wahrheit oder Unwahrheit, sondern nur um ihre Zweckmäßigkeit in bezug auf<br />
die Hinlenkung zum Anfang. Irrtum oder Wahrheit liegen bereits innerhalb des Erkenntnisprozesses.<br />
Den zweiten Einwand pariert Steiner mit dem Argument, daß die Grenze<br />
zwischen Gegebenem <strong>und</strong> Erkanntem gar nicht anders als künstlich gezogen werden<br />
kann, dies aber auf jeder Entwicklungsstufe des Menschen bei richtiger Schnittführung<br />
zwischen dem möglich ist, „was ohne gedankliche Bestimmung vor dem Erkennen an uns<br />
herantritt, <strong>und</strong> dem, was durch letzteres daraus erst gemacht wird.“ 5<br />
4 GA 3, S. 137.<br />
5 GA 3, 138 f., vgl. 137, 140.<br />
H.J. Scheurle 1984 scheint die Unterscheidung von blicklenkender <strong>und</strong> charakterisierender Begriffsverwendung<br />
bei Steiner zu ignorieren (Vgl. S.52f.). Scheurles Untersuchung der „Gesamtsinnesorganisation“ ist ein<br />
bedeutender Beitrag zur Gr<strong>und</strong>legung einer phänomenologischen Sinneslehre <strong>und</strong> erweckt Sympathie durch<br />
ihre <strong>und</strong>ogmatische Attitüde. In erkenntnistheoretischer Hinsicht bleibt sie aber letztlich unbefriedigend. Scheurle<br />
fragt, worin „überhaupt irgend ein greifbarer Unterschied zwischen Wahrnehmung <strong>und</strong> Denken“ bestehen soll<br />
(S. 18), da wir doch im Denken Ideen <strong>und</strong> Wortbedeutungen wahrnehmen, im Hören <strong>und</strong> Sehen Farben <strong>und</strong><br />
Töne <strong>und</strong> in beiden Fällen keine passive Rezeption vorliegt, sondern eine intentionale Beziehung. Doch besteht<br />
nicht ein entscheidender Unterschied darin, daß bei der Begriffswahrnehmung die gerichtete Aufmerksamkeit<br />
des Ich einem Gebilde seiner eigenen denkenden Tätigkeit gilt, während es bei sonstigen Wahrnehmungen mit<br />
einem gegebenen Inhalt zu tun hat, den es nicht hervorbringt?<br />
Und wie soll die Klippe des subjektiven Idealismus <strong>und</strong> Phänomenalismus umschifft werden, wenn die Nichtigkeit<br />
einer nicht etwa von der Wahrnehmbarkeit, sondern von der Wahrnehmung, also dem aktuellen Wahrgenommenwerden,<br />
unabhängigen Objektwelt postuliert wird? (S. 28)<br />
Es ist Scheurles Verdienst, auf die Problematik des Verhältnisses zwischen Steiners Sinneslehre, die er im<br />
wesentlichen akzeptiert, <strong>und</strong> Steiners Erkenntnistheorie hingewiesen zu haben, die er als noch dualistisch<br />
ablehnt. Es zeichnet sich ab, daß dieses Problem in der künftigen anthroposophischen Forschung noch eine<br />
große Rolle spielen wird. Die erkenntnistheoretische Spaltung von Wahrnehmung <strong>und</strong> Begriff stellt nach<br />
Scheurle ein Analogon der von ihm zu Recht kritisierten Subjekt-Objekt-Antinomie dar. Deren Zustandekommen<br />
führt er auf die statische Auffassung ihrem Wesen nach dynamischer Begriffe zurück. Uns scheint jedoch, daß<br />
Steiner Wahrnehmung <strong>und</strong> Begriff bzw. Intuition <strong>und</strong> Beobachtung durchaus nicht als starres Gegenüber, sondern<br />
als dynamische Polarität begreift, was den Dualismus-Vorwurf gegenstandslos machen würde. Das Denken<br />
ist <strong>für</strong> Steiner nicht eine separate, über der Sinnlichkeit thronende Sphäre, sondern die Funktion, die die<br />
dumpferen Sinnesreize zur vollen Klarheit aufhellt, indem sie den in ihnen enthaltenen, dem Subjekt aber vor<br />
der Erkenntnis unzugänglichen Geistgehalt in die Unverborgenheit hinaufhebt.<br />
Faßt man das Verhältnis von Sinneswahrnehmung <strong>und</strong> Denken dynamisch, wird man in bezug auf die Diagnose<br />
eines Widerspruchs zwischen Steinerscher Sinneslehre <strong>und</strong> Steinerscher Erkenntnistheorie zurückhaltender<br />
sein als Scheurle. Steiner lehnt in dem <strong>Anthroposophie</strong>-Fragment von 1910 (GA 45) die einfache Gegenübersetzung<br />
von Sinneswahrnehmung <strong>und</strong> begrifflichem Denken ab, weil sie „den notwendigen freien Ausblick<br />
auf die Tatsache verstellt, daß zum Beispiel die Geruchsempfindung sehr ferne dem Begriffserlebnis steht,<br />
daß aber der Gehörsinn als Sinneswahrnehmung sich schon dem annähert, was im Innern der Seele als solches<br />
Erlebnis vorhanden ist.“ (S. 40) Scheurle nimmt an, daß Steiner durch das Konstatieren eines Wortsinns<br />
<strong>und</strong> eines Gedankensinns das Denken der Sinneswahrnehmung subsumiert. Steiner will diese Sinne jedoch als<br />
einfaches, unmittelbares <strong>und</strong> urteilsfreies Verhältnis zu Wort bzw. Begriff charakterisiert wissen. Er beschreibt<br />
den Begriffssinn in dem Text von 1910 nicht etwa als Auffassungsvermögen <strong>für</strong> Begriffe schlechthin, sondern<br />
als das Verständnis <strong>für</strong> die Begriffe eines anderen, „der sich durch Lautsprache, Gestus usw. mitteilt“, <strong>und</strong> zwar<br />
nur insoweit, als in diesem Verständnis noch nicht Urteil, Gedächtnis usw. wirkt. (S. 37) Es handele sich um ein<br />
Verständnis <strong>für</strong> dasjenige, wo<strong>für</strong> „man es noch gar nicht zu einer Urteilsfähigkeit gebracht hat“ (ibd.).<br />
Der eigentliche Erkenntnisvorgang hat es dagegen immer mit der Urteilsbildung in Form von Wahrnehmungs-<br />
<strong>und</strong> Begriffsurteilen, d.h. mit der Tätigkeit des bewußten Hervorbringens von Verknüpfungen zu tun <strong>und</strong><br />
erfordert ein weit höheres Maß an Selbständigkeit als die charakterisierte unmittelbare Begriffsauffassung. Als<br />
deren Organ bezeichnet Steiner übrigens in dem angeführten Text die im vergangenen Leben eines Menschen<br />
bereits erworbenen Begriffe. (S. 75) Die Schwierigkeit scheint darin zu liegen, daß die Sinnesorganisation nicht<br />
einfach naturgegeben ist, sondern eine Entwicklung infolge der menschlichen Tätigkeit durchmacht <strong>und</strong> daß<br />
das Denken die Sinnesorganisation nicht nur ergänzt, sondern auch modifiziert. Das scheint auch der Gr<strong>und</strong><br />
da<strong>für</strong> zu sein, daß man die Grenze zwischen Gegebenem <strong>und</strong> Erkanntem zunächst künstlich ziehen muß, um<br />
sich klarzumachen, worin der eigentliche Erkenntnisvorgang besteht.<br />
103