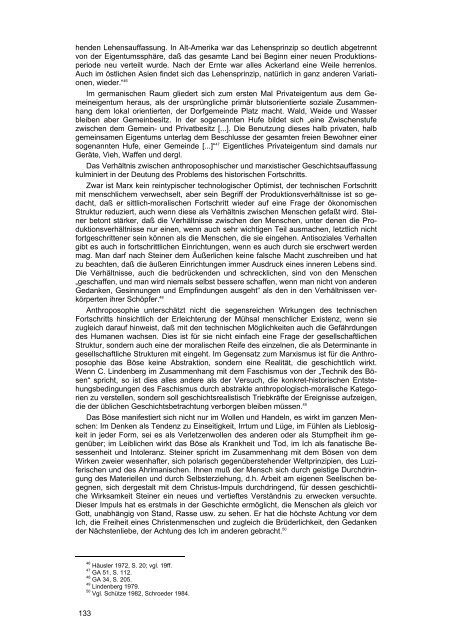Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
henden Lehensauffassung. In Alt-Amerika war das Lehensprinzip so deutlich abgetrennt<br />
von der Eigentumssphäre, daß das gesamte Land bei Beginn einer neuen Produktionsperiode<br />
neu verteilt wurde. Nach der Ernte war alles Ackerland eine Weile herrenlos.<br />
Auch im östlichen Asien findet sich das Lehensprinzip, natürlich in ganz anderen Variationen,<br />
wieder.“ 46<br />
Im germanischen Raum gliedert sich zum ersten Mal Privateigentum aus dem Gemeineigentum<br />
heraus, als der ursprüngliche primär blutsorientierte <strong>soziale</strong> Zusammenhang<br />
dem lokal orientierten, der Dorfgemeinde Platz macht. Wald, Weide <strong>und</strong> Wasser<br />
bleiben aber Gemeinbesitz. In der sogenannten Hufe bildet sich „eine Zwischenstufe<br />
zwischen dem Gemein- <strong>und</strong> Privatbesitz [...]. Die Benutzung dieses halb privaten, halb<br />
gemeinsamen Eigentums unterlag dem Beschlusse der gesamten freien Bewohner einer<br />
sogenannten Hufe, einer Gemeinde [...]“ 47 Eigentliches Privateigentum sind damals nur<br />
Geräte, Vieh, Waffen <strong>und</strong> dergl.<br />
Das Verhältnis zwischen anthroposophischer <strong>und</strong> marxistischer Geschichtsauffassung<br />
kulminiert in der Deutung des Problems des historischen Fortschritts.<br />
Zwar ist Marx kein reintypischer technologischer Optimist, der technischen Fortschritt<br />
mit menschlichem verwechselt, aber sein Begriff der Produktionsverhältnisse ist so gedacht,<br />
daß er sittlich-moralischen Fortschritt wieder auf eine Frage der ökonomischen<br />
Struktur reduziert, auch wenn diese als Verhältnis zwischen Menschen gefaßt wird. Steiner<br />
betont stärker, daß die Verhältnisse zwischen den Menschen, unter denen die Produktionsverhältnisse<br />
nur einen, wenn auch sehr wichtigen Teil ausmachen, letztlich nicht<br />
fortgeschrittener sein können als die Menschen, die sie eingehen. Anti<strong>soziale</strong>s Verhalten<br />
gibt es auch in fortschrittlichen Einrichtungen, wenn es auch durch sie erschwert werden<br />
mag. Man darf nach Steiner dem Äußerlichen keine falsche Macht zuschreiben <strong>und</strong> hat<br />
zu beachten, daß die äußeren Einrichtungen immer Ausdruck eines inneren Lebens sind.<br />
Die Verhältnisse, auch die bedrückenden <strong>und</strong> schrecklichen, sind von den Menschen<br />
„geschaffen, <strong>und</strong> man wird niemals selbst bessere schaffen, wenn man nicht von anderen<br />
Gedanken, Gesinnungen <strong>und</strong> Empfindungen ausgeht“ als den in den Verhältnissen verkörperten<br />
ihrer Schöpfer. 48<br />
<strong>Anthroposophie</strong> unterschätzt nicht die segensreichen Wirkungen des technischen<br />
Fortschritts hinsichtlich der Erleichterung der Mühsal menschlicher Existenz, wenn sie<br />
zugleich darauf hinweist, daß mit den technischen Möglichkeiten auch die Gefährdungen<br />
des Humanen wachsen. Dies ist <strong>für</strong> sie nicht einfach eine Frage der gesellschaftlichen<br />
Struktur, sondern auch eine der moralischen Reife des einzelnen, die als Determinante in<br />
gesellschaftliche Strukturen mit eingeht. Im Gegensatz zum <strong>Marxismus</strong> ist <strong>für</strong> die <strong>Anthroposophie</strong><br />
das Böse keine Abstraktion, sondern eine Realität, die geschichtlich wirkt.<br />
Wenn C. Lindenberg im Zusammenhang mit dem Faschismus von der „Technik des Bösen“<br />
spricht, so ist dies alles andere als der Versuch, die konkret-historischen Entstehungsbedingungen<br />
des Faschismus durch abstrakte anthropologisch-moralische Kategorien<br />
zu verstellen, sondern soll geschichtsrealistisch Triebkräfte der Ereignisse aufzeigen,<br />
die der üblichen Geschichtsbetrachtung verborgen bleiben müssen. 49<br />
Das Böse manifestiert sich nicht nur im Wollen <strong>und</strong> Handeln, es wirkt im ganzen Menschen:<br />
Im Denken als Tendenz zu Einseitigkeit, Irrtum <strong>und</strong> Lüge, im Fühlen als Lieblosigkeit<br />
in jeder Form, sei es als Verletzenwollen des anderen oder als Stumpfheit ihm gegenüber;<br />
im Leiblichen wirkt das Böse als Krankheit <strong>und</strong> Tod, im Ich als fanatische Besessenheit<br />
<strong>und</strong> Intoleranz. Steiner spricht im Zusammenhang mit dem Bösen von dem<br />
Wirken zweier wesenhafter, sich polarisch gegenüberstehender Weltprinzipien, des Luziferischen<br />
<strong>und</strong> des Ahrimanischen. Ihnen muß der Mensch sich durch geistige Durchdringung<br />
des Materiellen <strong>und</strong> durch Selbsterziehung, d.h. Arbeit am eigenen Seelischen begegnen,<br />
sich dergestalt mit dem Christus-Impuls durchdringend, <strong>für</strong> dessen geschichtliche<br />
Wirksamkeit Steiner ein neues <strong>und</strong> vertieftes Verständnis zu erwecken versuchte.<br />
Dieser Impuls hat es erstmals in der Geschichte ermöglicht, die Menschen als gleich vor<br />
Gott, unabhängig von Stand, Rasse usw. zu sehen. Er hat die höchste Achtung vor dem<br />
Ich, die Freiheit eines Christenmenschen <strong>und</strong> zugleich die Brüderlichkeit, den Gedanken<br />
der Nächstenliebe, der Achtung des Ich im anderen gebracht. 50<br />
133<br />
46 Häusler 1972, S. 20; vgl. 19ff.<br />
47 GA 51, S. 112.<br />
48 GA 34, S. 205.<br />
49 Lindenberg 1979.<br />
50 Vgl. Schütze 1982, Schroeder 1984.