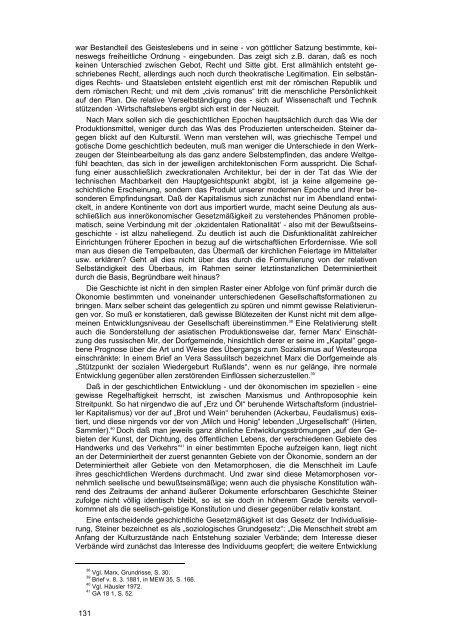Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
war Bestandteil des Geisteslebens <strong>und</strong> in seine - von göttlicher Satzung bestimmte, keineswegs<br />
freiheitliche Ordnung - eingeb<strong>und</strong>en. Das zeigt sich z.B. daran, daß es noch<br />
keinen Unterschied zwischen Gebot, Recht <strong>und</strong> Sitte gibt. Erst allmählich entsteht geschriebenes<br />
Recht, allerdings auch noch durch theokratische Legitimation. Ein selbständiges<br />
Rechts- <strong>und</strong> Staatsleben entsteht eigentlich erst mit der römischen Republik <strong>und</strong><br />
dem römischen Recht; <strong>und</strong> mit dem „civis romanus“ tritt die menschliche Persönlichkeit<br />
auf den Plan. Die relative Verselbständigung des - sich auf Wissenschaft <strong>und</strong> Technik<br />
stützenden -Wirtschaftslebens ergibt sich erst in der Neuzeit.<br />
Nach Marx sollen sich die geschichtlichen Epochen hauptsächlich durch das Wie der<br />
Produktionsmittel, weniger durch das Was des Produzierten unterscheiden. Steiner dagegen<br />
blickt auf den Kulturstil. Wenn man verstehen will, was griechische Tempel <strong>und</strong><br />
gotische Dome geschichtlich bedeuten, muß man weniger die Unterschiede in den Werkzeugen<br />
der Steinbearbeitung als das ganz andere Selbstempfinden, das andere Weltgefühl<br />
beachten, das sich in der jeweiligen architektonischen Form ausspricht. Die Schaffung<br />
einer ausschließlich zweckrationalen Architektur, bei der in der Tat das Wie der<br />
technischen Machbarkeit den Hauptgesichtspunkt abgibt, ist ja keine allgemeine geschichtliche<br />
Erscheinung, sondern das Produkt unserer modernen Epoche <strong>und</strong> ihrer besonderen<br />
Empfindungsart. Daß der Kapitalismus sich zunächst nur im Abendland entwickelt,<br />
in andere Kontinente von dort aus importiert wurde, macht seine Deutung als ausschließlich<br />
aus innerökonomischer Gesetzmäßigkeit zu verstehendes Phänomen problematisch,<br />
seine Verbindung mit der ,okzidentalen Rationalität‘ - also mit der Bewußtseinsgeschichte<br />
- ist allzu naheliegend. Zu deutlich ist auch die Disfunktionalität zahlreicher<br />
Einrichtungen früherer Epochen in bezug auf die wirtschaftlichen Erfordernisse. Wie soll<br />
man aus diesen die Tempelbauten, das Übermaß der kirchlichen Feiertage im Mittelalter<br />
usw. erklären? Geht all dies nicht über das durch die Formulierung von der relativen<br />
Selbständigkeit des Überbaus, im Rahmen seiner letztinstanzlichen Determiniertheit<br />
durch die Basis, Begründbare weit hinaus?<br />
Die Geschichte ist nicht in den simplen Raster einer Abfolge von fünf primär durch die<br />
Ökonomie bestimmten <strong>und</strong> voneinander unterschiedenen Gesellschaftsformationen zu<br />
bringen. Marx selber scheint das gelegentlich zu spüren <strong>und</strong> nimmt gewisse Relativierungen<br />
vor. So muß er konstatieren, daß gewisse Blütezeiten der Kunst nicht mit dem allgemeinen<br />
Entwicklungsniveau der Gesellschaft übereinstimmen. 38 Eine Relativierung stellt<br />
auch die Sonderstellung der asiatischen Produktionsweise dar, ferner Marx‘ Einschätzung<br />
des russischen Mir, der Dorfgemeinde, hinsichtlich derer er seine im „Kapital“ gegebene<br />
Prognose über die Art <strong>und</strong> Weise des Übergangs zum Sozialismus auf Westeuropa<br />
einschränkte: In einem Brief an Vera Sassulitsch bezeichnet Marx die Dorfgemeinde als<br />
„Stützpunkt der <strong>soziale</strong>n Wiedergeburt Rußlands“, wenn es nur gelänge, ihre normale<br />
Entwicklung gegenüber allen zerstörenden Einflüssen sicherzustellen. 39<br />
Daß in der geschichtlichen Entwicklung - <strong>und</strong> der ökonomischen im speziellen - eine<br />
gewisse Regelhaftigkeit herrscht, ist zwischen <strong>Marxismus</strong> <strong>und</strong> <strong>Anthroposophie</strong> kein<br />
Streitpunkt. So hat nirgendwo die auf „Erz <strong>und</strong> Öl“ beruhende Wirtschaftsform (industrieller<br />
Kapitalismus) vor der auf „Brot <strong>und</strong> Wein“ beruhenden (Ackerbau, Feudalismus) existiert,<br />
<strong>und</strong> diese nirgends vor der von „Milch <strong>und</strong> Honig“ lebenden „Urgesellschaft“ (Hirten,<br />
Sammler). 40 Doch daß man jeweils ganz ähnliche Entwicklungsströmungen „auf den Gebieten<br />
der Kunst, der Dichtung, des öffentlichen Lebens, der verschiedenen Gebiete des<br />
Handwerks <strong>und</strong> des Verkehrs“ 41 in einer bestimmten Epoche aufzeigen kann, liegt nicht<br />
an der Determiniertheit der zuerst genannten Gebiete von der Ökonomie, sondern an der<br />
Determiniertheit aller Gebiete von den Metamorphosen, die die Menschheit im Laufe<br />
ihres geschichtlichen Werdens durchmacht. Und zwar sind diese Metamorphosen vornehmlich<br />
seelische <strong>und</strong> bewußtseinsmäßige; wenn auch die physische Konstitution während<br />
des Zeitraums der anhand äußerer Dokumente erforschbaren Geschichte Steiner<br />
zufolge nicht völlig identisch bleibt, so ist sie doch in höherem Grade bereits vervollkommnet<br />
als die seelisch-geistige Konstitution <strong>und</strong> dieser gegenüber relativ konstant.<br />
Eine entscheidende geschichtliche Gesetzmäßigkeit ist das Gesetz der Individualisierung,<br />
Steiner bezeichnet es als „soziologisches Gr<strong>und</strong>gesetz“: „Die Menschheit strebt am<br />
Anfang der Kulturzustände nach Entstehung <strong>soziale</strong>r Verbände; dem Interesse dieser<br />
Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung<br />
38<br />
Vgl. Marx, Gr<strong>und</strong>risse, S. 30.<br />
39<br />
Brief v. 8. 3. 1881, in MEW 35, S. 166.<br />
40<br />
Vgl. Häusler 1972.<br />
41<br />
GA 18 1, S. 52.<br />
131