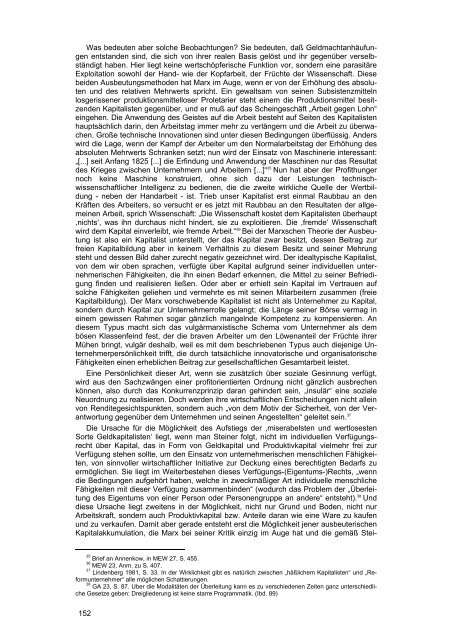Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Was bedeuten aber solche Beobachtungen? Sie bedeuten, daß Geldmachtanhäufungen<br />
entstanden sind, die sich von ihrer realen Basis gelöst <strong>und</strong> ihr gegenüber verselbständigt<br />
haben. Hier liegt keine wertschöpferische Funktion vor, sondern eine parasitäre<br />
Exploitation sowohl der Hand- wie der Kopfarbeit, der Früchte der Wissenschaft. Diese<br />
beiden Ausbeutungsmethoden hat Marx im Auge, wenn er von der Erhöhung des absoluten<br />
<strong>und</strong> des relativen Mehrwerts spricht. Ein gewaltsam von seinen Subsistenzmitteln<br />
losgerissener produktionsmittelloser Proletarier steht einem die Produktionsmittel besitzenden<br />
Kapitalisten gegenüber, <strong>und</strong> er muß auf das Scheingeschäft „Arbeit gegen Lohn“<br />
eingehen. Die Anwendung des Geistes auf die Arbeit besteht auf Seiten des Kapitalisten<br />
hauptsächlich darin, den Arbeitstag immer mehr zu verlängern <strong>und</strong> die Arbeit zu überwachen.<br />
Große technische Innovationen sind unter diesen Bedingungen überflüssig. Anders<br />
wird die Lage, wenn der Kampf der Arbeiter um den Normalarbeitstag der Erhöhung des<br />
absoluten Mehrwerts Schranken setzt; nun wird der Einsatz von Maschinerie interessant:<br />
„[...] seit Anfang 1825 [...] die Erfindung <strong>und</strong> Anwendung der Maschinen nur das Resultat<br />
des Krieges zwischen Unternehmern <strong>und</strong> Arbeitern [...]“ 35 Nun hat aber der Profithunger<br />
noch keine Maschine konstruiert, ohne sich dazu der Leistungen technischwissenschaftlicher<br />
Intelligenz zu bedienen, die die zweite wirkliche Quelle der Wertbildung<br />
- neben der Handarbeit - ist. Trieb unser Kapitalist erst einmal Raubbau an den<br />
Kräften des Arbeiters, so versucht er es jetzt mit Raubbau an den Resultaten der allgemeinen<br />
Arbeit, sprich Wissenschaft: „Die Wissenschaft kostet dem Kapitalisten überhaupt<br />
,nichts‘, was ihn durchaus nicht hindert, sie zu exploitieren. Die ,fremde‘ Wissenschaft<br />
wird dem Kapital einverleibt, wie fremde Arbeit.“ 36 Bei der Marxschen Theorie der Ausbeutung<br />
ist also ein Kapitalist unterstellt, der das Kapital zwar besitzt, dessen Beitrag zur<br />
freien Kapitalbildung aber in keinem Verhältnis zu diesem Besitz <strong>und</strong> seiner Mehrung<br />
steht <strong>und</strong> dessen Bild daher zurecht negativ gezeichnet wird. Der idealtypische Kapitalist,<br />
von dem wir oben sprachen, verfügte über Kapital aufgr<strong>und</strong> seiner individuellen unternehmerischen<br />
Fähigkeiten, die ihn einen Bedarf erkennen, die Mittel zu seiner Befriedigung<br />
finden <strong>und</strong> realisieren ließen. Oder aber er erhielt sein Kapital im Vertrauen auf<br />
solche Fähigkeiten geliehen <strong>und</strong> vermehrte es mit seinen Mitarbeitern zusammen (freie<br />
Kapitalbildung). Der Marx vorschwebende Kapitalist ist nicht als Unternehmer zu Kapital,<br />
sondern durch Kapital zur Unternehmerrolle gelangt; die Länge seiner Börse vermag in<br />
einem gewissen Rahmen sogar gänzlich mangelnde Kompetenz zu kompensieren. An<br />
diesem Typus macht sich das vulgärmarxistische Schema vom Unternehmer als dem<br />
bösen Klassenfeind fest, der die braven Arbeiter um den Löwenanteil der Früchte ihrer<br />
Mühen bringt, vulgär deshalb, weil es mit dem beschriebenen Typus auch diejenige Unternehmerpersönlichkeit<br />
trifft, die durch tatsächliche innovatorische <strong>und</strong> organisatorische<br />
Fähigkeiten einen erheblichen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit leistet.<br />
Eine Persönlichkeit dieser Art, wenn sie zusätzlich über <strong>soziale</strong> Gesinnung verfügt,<br />
wird aus den Sachzwängen einer profitorientierten Ordnung nicht gänzlich ausbrechen<br />
können, also durch das Konkurrenzprinzip daran gehindert sein, „insulär“ eine <strong>soziale</strong><br />
Neuordnung zu realisieren. Doch werden ihre wirtschaftlichen Entscheidungen nicht allein<br />
von Renditegesichtspunkten, sondern auch „von dem Motiv der Sicherheit, von der Verantwortung<br />
gegenüber dem Unternehmen <strong>und</strong> seinen Angestellten“ geleitet sein. 37<br />
Die Ursache <strong>für</strong> die Möglichkeit des Aufstiegs der ,miserabelsten <strong>und</strong> wertlosesten<br />
Sorte Geldkapitalisten‘ liegt, wenn man Steiner folgt, nicht im individuellen Verfügungsrecht<br />
über Kapital, das in Form von Geldkapital <strong>und</strong> Produktivkapital vielmehr frei zur<br />
Verfügung stehen sollte, um den Einsatz von unternehmerischen menschlichen Fähigkeiten,<br />
von sinnvoller wirtschaftlicher Initiative zur Deckung eines berechtigten Bedarfs zu<br />
ermöglichen. Sie liegt im Weiterbestehen dieses Verfügungs-(Eigentums-)Rechts, „wenn<br />
die Bedingungen aufgehört haben, welche in zweckmäßiger Art individuelle menschliche<br />
Fähigkeiten mit dieser Verfügung zusammenbinden“ (wodurch das Problem der „Überleitung<br />
des Eigentums von einer Person oder Personengruppe an andere“ entsteht). 38 Und<br />
diese Ursache liegt zweitens in der Möglichkeit, nicht nur Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden, nicht nur<br />
Arbeitskraft, sondern auch Produktivkapital bzw. Anteile daran wie eine Ware zu kaufen<br />
<strong>und</strong> zu verkaufen. Damit aber gerade entsteht erst die Möglichkeit jener ausbeuterischen<br />
Kapitalakkumulation, die Marx bei seiner Kritik einzig im Auge hat <strong>und</strong> die gemäß Stei-<br />
35<br />
Brief an Annenkow, in MEW 27, S. 455.<br />
36<br />
MEW 23, Anm. zu S. 407.<br />
37<br />
Lindenberg 1981, S. 33. In der Wirklichkeit gibt es natürlich zwischen „häßlichem Kapitalisten“ <strong>und</strong> „Reformunternehmer“<br />
alle möglichen Schattierungen.<br />
38<br />
GA 23, S. 87. Uber die Modalitäten der Überleitung kann es zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche<br />
Gesetze geben: Dreigliederung ist keine starre Programmatik. (Ibd. 89)<br />
152