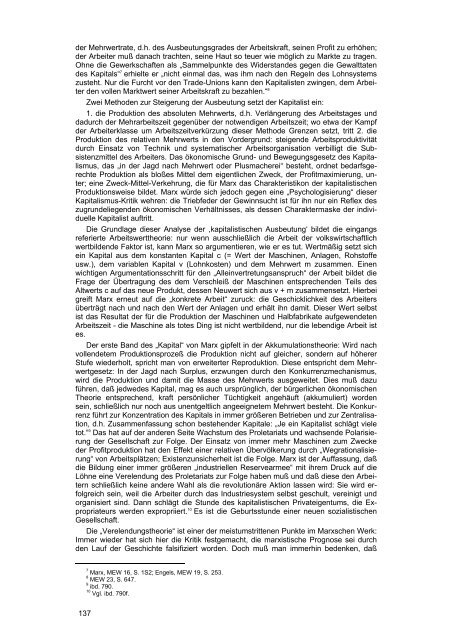Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der Mehrwertrate, d.h. des Ausbeutungsgrades der Arbeitskraft, seinen Profit zu erhöhen;<br />
der Arbeiter muß danach trachten, seine Haut so teuer wie möglich zu Markte zu tragen.<br />
Ohne die Gewerkschaften als „Sammelpunkte des Widerstandes gegen die Gewalttaten<br />
des Kapitals“ 7 erhielte er „nicht einmal das, was ihm nach den Regeln des Lohnsystems<br />
zusteht. Nur die Furcht vor den Trade-Unions kann den Kapitalisten zwingen, dem Arbeiter<br />
den vollen Marktwert seiner Arbeitskraft zu bezahlen.“ 8<br />
Zwei Methoden zur Steigerung der Ausbeutung setzt der Kapitalist ein:<br />
1. die Produktion des absoluten Mehrwerts, d.h. Verlängerung des Arbeitstages <strong>und</strong><br />
dadurch der Mehrarbeitszeit gegenüber der notwendigen Arbeitszeit; wo etwa der Kampf<br />
der Arbeiterklasse um Arbeitszeitverkürzung dieser Methode Grenzen setzt, tritt 2. die<br />
Produktion des relativen Mehrwerts in den Vordergr<strong>und</strong>: steigende Arbeitsproduktivität<br />
durch Einsatz von Technik <strong>und</strong> systematischer Arbeitsorganisation verbilligt die Subsistenzmittel<br />
des Arbeiters. Das ökonomische Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsgesetz des Kapitalismus,<br />
das „in der Jagd nach Mehrwert oder Plusmacherei“ besteht, ordnet bedarfsgerechte<br />
Produktion als bloßes Mittel dem eigentlichen Zweck, der Profitmaximierung, unter;<br />
eine Zweck-Mittel-Verkehrung, die <strong>für</strong> Marx das Charakteristikon der kapitalistischen<br />
Produktionsweise bildet. Marx würde sich jedoch gegen eine „Psychologisierung“ dieser<br />
Kapitalismus-Kritik wehren: die Triebfeder der Gewinnsucht ist <strong>für</strong> ihn nur ein Reflex des<br />
zugr<strong>und</strong>eliegenden ökonomischen Verhältnisses, als dessen Charaktermaske der individuelle<br />
Kapitalist auftritt.<br />
Die Gr<strong>und</strong>lage dieser Analyse der ,kapitalistischen Ausbeutung‘ bildet die eingangs<br />
referierte Arbeitswerttheorie: nur wenn ausschließlich die Arbeit der volkswirtschaftlich<br />
wertbildende Faktor ist, kann Marx so argumentieren, wie er es tut. Wertmäßig setzt sich<br />
ein Kapital aus dem konstanten Kapital c (= Wert der Maschinen, Anlagen, Rohstoffe<br />
usw.), dem variablen Kapital v (Lohnkosten) <strong>und</strong> dem Mehrwert m zusammen. Einen<br />
wichtigen Argumentationsschritt <strong>für</strong> den „Alleinvertretungsanspruch“ der Arbeit bildet die<br />
Frage der Übertragung des dem Verschleiß der Maschinen entsprechenden Teils des<br />
Altwerts c auf das neue Produkt, dessen Neuwert sich aus v + m zusammensetzt. Hierbei<br />
greift Marx erneut auf die „konkrete Arbeit“ zuruck: die Geschicklichkeit des Arbeiters<br />
überträgt nach <strong>und</strong> nach den Wert der Anlagen <strong>und</strong> erhält ihn damit. Dieser Wert selbst<br />
ist das Resultat der <strong>für</strong> die Produktion der Maschinen <strong>und</strong> Halbfabrikate aufgewendeten<br />
Arbeitszeit - die Maschine als totes Ding ist nicht wertbildend, nur die lebendige Arbeit ist<br />
es.<br />
Der erste Band des „Kapital“ von Marx gipfelt in der Akkumulationstheorie: Wird nach<br />
vollendetem Produktionsprozeß die Produktion nicht auf gleicher, sondern auf höherer<br />
Stufe wiederholt, spricht man von erweiterter Reproduktion. Diese entspricht dem Mehrwertgesetz:<br />
In der Jagd nach Surplus, erzwungen durch den Konkurrenzmechanismus,<br />
wird die Produktion <strong>und</strong> damit die Masse des Mehrwerts ausgeweitet. Dies muß dazu<br />
führen, daß jedwedes Kapital, mag es auch ursprünglich, der bürgerlichen ökonomischen<br />
Theorie entsprechend, kraft persönlicher Tüchtigkeit angehäuft (akkumuliert) worden<br />
sein, schließlich nur noch aus unentgeltlich angeeignetem Mehrwert besteht. Die Konkurrenz<br />
führt zur Konzentration des Kapitals in immer größeren Betrieben <strong>und</strong> zur Zentralisation,<br />
d.h. Zusammenfassung schon bestehender Kapitale: „Je ein Kapitalist schlägt viele<br />
tot.“ 9 Das hat auf der anderen Seite Wachstum des Proletariats <strong>und</strong> wachsende Polarisierung<br />
der Gesellschaft zur Folge. Der Einsatz von immer mehr Maschinen zum Zwecke<br />
der Profitproduktion hat den Effekt einer relativen Übervölkerung durch „Wegrationalisierung“<br />
von Arbeitsplätzen; Existenzunsicherheit ist die Folge. Marx ist der Auffassung, daß<br />
die Bildung einer immer größeren „industriellen Reservearmee“ mit ihrem Druck auf die<br />
Löhne eine Verelendung des Proletariats zur Folge haben muß <strong>und</strong> daß diese den Arbeitern<br />
schließlich keine andere Wahl als die revolutionäre Aktion lassen wird: Sie wird erfolgreich<br />
sein, weil die Arbeiter durch das Industriesystem selbst geschult, vereinigt <strong>und</strong><br />
organisiert sind. Dann schlägt die St<strong>und</strong>e des kapitalistischen Privateigentums, die Expropriateurs<br />
werden expropriiert. 10 Es ist die Geburtsst<strong>und</strong>e einer neuen sozialistischen<br />
Gesellschaft.<br />
Die „Verelendungstheorie“ ist einer der meistumstrittenen Punkte im Marxschen Werk:<br />
Immer wieder hat sich hier die Kritik festgemacht, die marxistische Prognose sei durch<br />
den Lauf der Geschichte falsifiziert worden. Doch muß man immerhin bedenken, daß<br />
7<br />
Marx, MEW 16, S. 1S2; Engels, MEW 19, S. 253.<br />
8<br />
MEW 23, S. 647.<br />
9<br />
ibd. 790.<br />
10<br />
Vgl. ibd. 790f.<br />
137