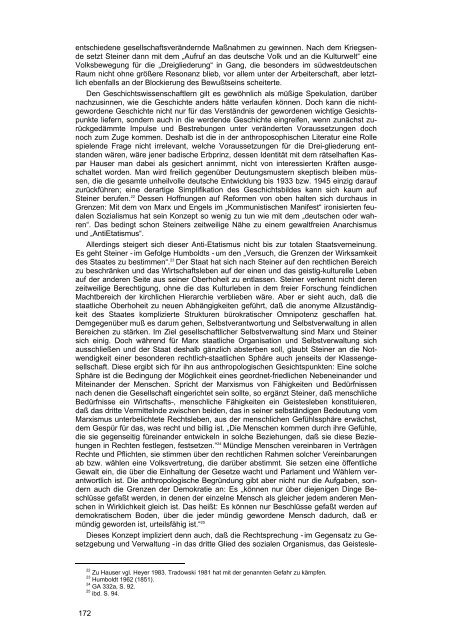Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Marxismus und Anthroposophie - Institut für soziale Gegenwartsfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
entschiedene gesellschaftsverändernde Maßnahmen zu gewinnen. Nach dem Kriegsende<br />
setzt Steiner dann mit dem „Aufruf an das deutsche Volk <strong>und</strong> an die Kulturwelt“ eine<br />
Volksbewegung <strong>für</strong> die „Dreigliederung“ in Gang, die besonders im südwestdeutschen<br />
Raum nicht ohne größere Resonanz blieb, vor allem unter der Arbeiterschaft, aber letztlich<br />
ebenfalls an der Blockierung des Bewußtseins scheiterte.<br />
Den Geschichtswissenschaftlern gilt es gewöhnlich als müßige Spekulation, darüber<br />
nachzusinnen, wie die Geschichte anders hätte verlaufen können. Doch kann die nichtgewordene<br />
Geschichte nicht nur <strong>für</strong> das Verständnis der gewordenen wichtige Gesichtspunkte<br />
liefern, sondern auch in die werdende Geschichte eingreifen, wenn zunächst zurückgedämmte<br />
Impulse <strong>und</strong> Bestrebungen unter veränderten Voraussetzungen doch<br />
noch zum Zuge kommen. Deshalb ist die in der anthroposophischen Literatur eine Rolle<br />
spielende Frage nicht irrelevant, welche Voraussetzungen <strong>für</strong> die Drei-gliederung entstanden<br />
wären, wäre jener badische Erbprinz, dessen Identität mit dem rätselhaften Kaspar<br />
Hauser man dabei als gesichert annimmt, nicht von interessierten Kräften ausgeschaltet<br />
worden. Man wird freilich gegenüber Deutungsmustern skeptisch bleiben müssen,<br />
die die gesamte unheilvolle deutsche Entwicklung bis 1933 bzw. 1945 einzig darauf<br />
zurückführen; eine derartige Simplifikation des Geschichtsbildes kann sich kaum auf<br />
Steiner berufen. 22 Dessen Hoffnungen auf Reformen von oben halten sich durchaus in<br />
Grenzen: Mit dem von Marx <strong>und</strong> Engels im „Kommunistischen Manifest“ ironisierten feudalen<br />
Sozialismus hat sein Konzept so wenig zu tun wie mit dem „deutschen oder wahren“.<br />
Das bedingt schon Steiners zeitweilige Nähe zu einem gewaltfreien Anarchismus<br />
<strong>und</strong> „AntiEtatismus“.<br />
Allerdings steigert sich dieser Anti-Etatismus nicht bis zur totalen Staatsverneinung.<br />
Es geht Steiner - im Gefolge Humboldts - um den „Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit<br />
des Staates zu bestimmen“. 23 Der Staat hat sich nach Steiner auf den rechtlichen Bereich<br />
zu beschränken <strong>und</strong> das Wirtschaftsleben auf der einen <strong>und</strong> das geistig-kulturelle Leben<br />
auf der anderen Seite aus seiner Oberhoheit zu entlassen. Steiner verkennt nicht deren<br />
zeitweilige Berechtigung, ohne die das Kulturleben in dem freier Forschung feindlichen<br />
Machtbereich der kirchlichen Hierarchie verblieben wäre. Aber er sieht auch, daß die<br />
staatliche Oberhoheit zu neuen Abhängigkeiten geführt, daß die anonyme Allzuständigkeit<br />
des Staates komplizierte Strukturen bürokratischer Omnipotenz geschaffen hat.<br />
Demgegenüber muß es darum gehen, Selbstverantwortung <strong>und</strong> Selbstverwaltung in allen<br />
Bereichen zu stärken. Im Ziel gesellschaftlicher Selbstverwaltung sind Marx <strong>und</strong> Steiner<br />
sich einig. Doch während <strong>für</strong> Marx staatliche Organisation <strong>und</strong> Selbstverwaltung sich<br />
ausschließen <strong>und</strong> der Staat deshalb gänzlich absterben soll, glaubt Steiner an die Notwendigkeit<br />
einer besonderen rechtlich-staatlichen Sphäre auch jenseits der Klassengesellschaft.<br />
Diese ergibt sich <strong>für</strong> ihn aus anthropologischen Gesichtspunkten: Eine solche<br />
Sphäre ist die Bedingung der Möglichkeit eines geordnet-friedlichen Nebeneinander <strong>und</strong><br />
Miteinander der Menschen. Spricht der <strong>Marxismus</strong> von Fähigkeiten <strong>und</strong> Bedürfnissen<br />
nach denen die Gesellschaft eingerichtet sein sollte, so ergänzt Steiner, daß menschliche<br />
Bedürfnisse ein Wirtschafts-, menschliche Fähigkeiten ein Geistesleben konstituieren,<br />
daß das dritte Vermittelnde zwischen beiden, das in seiner selbständigen Bedeutung vom<br />
<strong>Marxismus</strong> unterbelichtete Rechtsleben, aus der menschlichen Gefühlssphäre erwächst,<br />
dem Gespür <strong>für</strong> das, was recht <strong>und</strong> billig ist. „Die Menschen kommen durch ihre Gefühle,<br />
die sie gegenseitig <strong>für</strong>einander entwickeln in solche Beziehungen, daß sie diese Beziehungen<br />
in Rechten festlegen, festsetzen.“ 24 Mündige Menschen vereinbaren in Verträgen<br />
Rechte <strong>und</strong> Pflichten, sie stimmen über den rechtlichen Rahmen solcher Vereinbarungen<br />
ab bzw. wählen eine Volksvertretung, die darüber abstimmt. Sie setzen eine öffentliche<br />
Gewalt ein, die über die Einhaltung der Gesetze wacht <strong>und</strong> Parlament <strong>und</strong> Wählern verantwortlich<br />
ist. Die anthropologische Begründung gibt aber nicht nur die Aufgaben, sondern<br />
auch die Grenzen der Demokratie an: Es „können nur über diejenigen Dinge Beschlüsse<br />
gefaßt werden, in denen der einzelne Mensch als gleicher jedem anderen Menschen<br />
in Wirklichkeit gleich ist. Das heißt: Es können nur Beschlüsse gefaßt werden auf<br />
demokratischem Boden, über die jeder mündig gewordene Mensch dadurch, daß er<br />
mündig geworden ist, urteilsfähig ist.“ 25<br />
Dieses Konzept impliziert denn auch, daß die Rechtsprechung - im Gegensatz zu Gesetzgebung<br />
<strong>und</strong> Verwaltung - in das dritte Glied des <strong>soziale</strong>n Organismus, das Geistesle-<br />
22<br />
Zu Hauser vgl. Heyer 1983. Tradowski 1981 hat mit der genannten Gefahr zu kämpfen.<br />
23<br />
Humboldt 1962 (1851).<br />
24<br />
GA 332a, S. 92.<br />
25<br />
ibd. S. 94.<br />
172